Einleitung
Zwei expansive Prozesse unterschiedlicher Art prägen die Neuzeit: Die religiös motivierte missionarische Verbreitung des Christentums und die politisch-ökonomisch motivierte Expansion der Kolonisierungen.1 An sich sind beide Prozesse nicht miteinander verbunden, doch in der Neuzeit scheinen beide expansive Prozesse verwechselbar und ununterscheidbar zu werden. Die Gründe dafür liegen in der Frühen Neuzeit vor allem darin, dass die beiden Hauptakteure, die iberischen Seemächte Portugal und Spanien, die Prozesse der Entdeckungsfahrten und Eroberungen initiierten und steuerten. Dabei erhielten sie Privilegien und Konzessionen durch päpstliche Bullen, die mit der Verpflichtung zur Evangelisierung und der Verleihung des Patronats (patronato, padroado) verbunden waren (Aussendung und Unterstützung von Missionaren und ihrer Arbeit im Hinblick auf die Bekehrung der neuentdeckten Völker und den Aufbau der Kirche dort). Aufgrund dieser politisch-religiösen Verbindung blieb die Mission zwar prinzipiell eine wesentlich kirchliche Angelegenheit, doch faktisch kam es zu einer engen Verquickung von Missionierung und Kolonisierung in Hispano- und Luso-Amerika, da staatliche und kirchliche (Rechts-)Sphären vermischt wurden.2
Missionierung
Zur katholischen Erneuerung vom 16. bis zum 18. Jahrhunderts gehörte auch der missionarische Impetus, der vor allem die religiösen Orden bewegte und sie in die unbekannten Welten Amerika und Asien trieb.3 Die logistischen Voraussetzungen und der Motivationsschub der Ordensleute angesichts der dortigen Bevölkerungszahlen bewog die humanistisch ausgebildeten Ordensleute, vor allem die auf mittelalterliche Wurzeln zurückgehenden Mendikanten der Franziskaner (ordo fratrum minorum)
Unter dem theologischen Begriff "Mission" versteht man die kirchliche Aufgabe, die christliche "gute Botschaft" (ευαγγέλιον - Evangelium) universal zu verbreiten. Alle vier Evangelien des Neuen Testaments berichten von der Sendung der "Apostel" durch Jesus mit dem Imperativ: "Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung." (Markus 16,15) Die Mission der Kirche setzt mithin die Mission Christi fort. Demnach kann das Christentum nicht von einer globalen missionarischen Verkündigung absehen, ohne seine Identität aufzugeben.
Diese Aufgabe benannte man im Mittelalter mit unterschiedlichen Bezeichnungen, wie "Verkündigung des Evangeliums" (promulgatio Evangelii), "Bekehrung der Ungläubigen" (conversio infidelium) oder "Verbreitung des Glaubens" (propagatio fidei), bis sich in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts der Neologismus "Mission" durchsetzte. Das änderte sich in der Mitte des 20. Jahrhunderts, als das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965) den formalen Begriff der Mission durch das biblische Leitwort der "Evangelisierung" inhaltlich ergänzte.
Im konfessionellen Zeitalter war Mission vornehmlich eine Angelegenheit der römisch-katholischen Kirche, die von Anfang an aus theologischen Gründen missionierte. Protestantische Mission begann erst im 18. und verstärkt im 19. Jahrhundert mit zahlreichen Missionsgesellschaften. Grund für diese protestantische Verspätung dürfte unter anderem die lutherische Tradition sein: sie sah durch die Apostel die Mission als erledigt an. Erweckungsbewegungen wie die Pietisten gaben erste Anstöße. Zudem konnten erst die protestantischen Seemächte Niederlande, England und Dänemark die nötige Logistik gewährleisten.
Missionarische Aktivitäten der Kirche folgen einer theologischen Eigenlogik, der biblisch begründeten Glaubensverbreitung in zahlreichen Ausprägungen. Mit den Missionsreisen des Apostels Paulus kamen Griechenland und Rom in den Blick; im frühen Mittelalter entsandte Papst Gregor der Große (540–604) von Rom aus Mönche nach England, während aus englischen Klöstern Bonifatius (673–754)[
Ab der Frühen Neuzeit aber wurde Missionierung oft mit Kolonisierung verbunden, obgleich sie jeweils unterschiedlichen und inkompatiblen Logiken folgten: Ging es den christlichen Missionaren darum, den Anderen das Eigene zu bringen, nämlich das immaterielle Gut des Glaubens, verbunden mit den Errungenschaften der westlichen Zivilisation, hatten die Kolonisten im Sinn, das Eigene der Anderen zu holen, nämlich deren materiellen Reichtümer, seien es Edelhölzer und -metalle, Gewürze oder Kolonialwaren. Diese widerstrebenden Logiken führten zu einer höchst ambivalenten Gemengelage, die erst durch Entflechtung wieder gelöst werden konnte.
Kolonisierung
Kolonien sind seit Langem bekannt. In der Antike emigrierten Phönizier und Griechen in den Mittelmeerraum und errichteten dort Kolonien; der Tempel im sizilianischen Agrigent erinnert daran. Jahrhunderte später gründeten die Römer Kolonien in ihrem Reich, etwa ihre "colonia" (Köln) am Rhein oder die "colonia patrizia" (Córdoba) am Guadalquivir. An diese historisch vertraute Figur der Antike konnten die iberischen Völker anknüpfen, als sie am Ende des 15. Jahrhunderts durch neue Schiffstypen und Navigationstechniken im Stande waren, überseeische Gebiete wie Amerika und Indien zu erreichen
In der Gegenwart bezeichnet der negativ konnotierte Begriff "Kolonialismus" ein System kolonialer Herrschaft, das durch Eroberung oder Landnahme entsteht und politische Unterdrückung und ökonomische Ausbeutung mit sich bringt. Der neuzeitliche Kolonialismus nimmt je nach zeitlicher Epoche, Geographie und beteiligten Akteuren vielfältige Formen an, zumal wenn missionarische Unternehmungen mit im Spiel waren. Grundsätzlich aber waren missionarische Expansion und kolonisierende Expansion keineswegs identische oder notwendig verbundene Prozesse, da ihre Intentionen, Pragmatiken und Zielsetzungen jeweils unterschiedlichen Prinzipien folgten. Politisch-ökonomische Handlungsformen und religiös-missionarische sind daher grundsätzlich zu unterscheiden.
In der Neuzeit unterscheidet man vor allem zwei Grundtypen von Kolonien:5 Stützpunktkolonien wie die der Portugiesen, die in Asien ein Netzwerk von Niederlassungen in überseeischen Territorien bildeten, ein dem Handel dienendes seaborn empire. Dagegen kontrollierten die Herrschaftskolonien wie Spanisch-Amerika Länder oder Reiche, um sie politisch einzugliedern und wirtschaftlich zu nutzen.
Amerika
Patronat, Conquista, Mission
Die "Katholischen Könige" Isabella von Kastilien und León (1451–1504) und Ferdinand von Aragón (1452–1516) hatten sich im Lauf der Zeit durch päpstliche Konzessionen das Patronat zusichern lassen. Beginnend mit der Bulle Inter caetera von 1493, in der Papst Alexander VI. (1431–1503) den Königen das alleinige Recht auf Missionierung der neu entdeckten Länder gewährte, folgte die Zuerkennung des Patronats durch Julius II. (1443–1513) mit der Bulle Universalis Ecclesiae regiminis vom 28. Juli 1508.6 So wurde die Krone für die Organisation des Kirchenwesens in der Neuen Welt und damit auch für die Missionsarbeit verantwortlich. Die Verwaltung des Patronats erfolgte über den Indienrat (Consejo de Indias), die Logistik über die Casa de Contratación in Sevilla. In der spanischen Kolonialzeit wurden über 14.000 Missionare aus den Orden nach Amerika entsandt. So geriet die Mission zunehmend in die Abhängigkeit von der Krone und wurde zugleich ins koloniale Herrschaftssystem eingebunden.
Nach der Eroberung der Karibischen Inseln Anfang des 16. Jahrhunderts kam es in schneller Folge zur Conquista des Aztekenreichs und seiner Hauptstadt Tenochtitlán (1519–1521) durch Hernán Cortés (1485–1547) sowie des Inkareiches (1531–1533) durch Francisco Pizarro (ca. 1478–1541), wobei die Herrscher Moctezuma II. (1466–1520) in Mexiko und Atahualpa (ca. 1502–1533) in Peru bald den Tod fanden. Damit entstand das spanische Kolonialreich, das im 17. Jahrhundert durch die beiden Vizekönigreiche Nueva España und Perú sowie durch die Audiencia Española (zirkumkaribischer Raum) verwaltet wurde.
Die frühen Zeugnisse der Verquickung von Missionierung und Kolonisierung stammen von dem katalanischen Hieronymit Ramón Pané, der von 1493 bis 1496 die zweite Reise von Christoph Columbus (1451–1506) in die Karibik begleitete und über den Aufenthalt auf La Española berichtete. Dort wirkte er als erster Missionar unter den Taino (Arwak) und studierte ihre Kultur und Religion. Die Christianisierung stand jedoch im Kontext der Conquista und der Ansiedlung von Kolonisten. Friedliche Mission und Kulturzusammenstoß prägten das Bild, das sowohl bei den Indios als auch bei den Spaniern zu einem ambivalenten "Wertewandel" führte, von dem Pané in seinem Bericht von 1498 erzählte.7
Später erreichten zahlreiche Berichte über die schlimmen Zustände in Amerika den spanischen Hof und die römische Kurie. Zwar wandten sich die Päpste in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts den Missionsproblemen zu, doch verbaten sich die Patronatsherren päpstliche "Einmischungen". Dennoch war eine Bewegung in Gang gekommen, um die Mission wieder in kirchliche Hand zu nehmen. Rom gründete eine eigenständige römische Zentralbehörde für die Mission, die Papst Gregor XV. (1554–1623) in Form einer römischen Congregatio de Propaganda Fide (dt.: Kongregation zur Verbreitung des Glaubens) errichtete (1622), um den unabdingbar religiösen Charakter zu betonen. Das kirchliche Konzept hierfür lieferte der erste Sekretär der Propaganda-Kongregation, der Italiener Francesco Ingoli (1578–1649), dem es gelang, die Mission stärker an Rom zu binden und allmählich von der Kolonialpolitik abzulösen, jedenfalls für die Länder außerhalb des spanischen patronato und des portugiesischen padroado. Überdies forderte er einen einheimischen Klerus und die Anpassung an die Kulturen der Länder, besonders an die Hochkulturen Asiens. Die päpstliche Missionsbehörde war also der erste institutionelle Versuch, die kirchliche Mission klar vom Kolonialismus zu distanzieren.
Frühe Kolonialkritik
Die frühe Kolonialkritik entzündete sich im 16. Jahrhundert insbesondere an der Institution der "Encomienda", die das Recht der Indios auf Unterhalt und Mission mit unfreier Arbeitspflicht verband und faktisch zum Missbrauch führte. Die Kritik an diesem System begann mit einem moralischen Aufstand des Gewissens im Jahr 1511, als der Dominikaner Antón de Montesinos (ca. 1480–1540)[
Noch im selben Jahrhundert führten zwei Protagonisten die argumentative Debatte gegen den Kolonialismus: Bartolomé de las Casas (1474–1566) bekehrte sich aufgrund eines alttestamentlichen Texts (Jesus Sirach 34, 21–27) und gab seine Encomienda auf; als Bischof von Chiapa (Mexiko) konnte er die Kolonisten seiner Diözese freilich nicht bekehren. Zurück in Spanien verfasste er zahlreiche kolonialkritische Schriften mit historischen, ethnographischen, sozialethischen und missionstheologischen Inhalten, von denen zu Lebzeiten nur wenige erschienen. Am bekanntesten ist sein vielfach übersetzter Traktat, bis heute ein Bestseller: Brevísima relación de la destrucción de las Indias (dt.: Kurzgefasster Bericht von der Verwüstung der Westindischen Länder)
Francisco de Vitoria (1483–1546) stellte die Rechtsgrundlagen der Eroberung Amerika infrage, obwohl er Amerika nicht aus eigener Anschauung kannte. Damit entfachte er einen systematischen Diskurs um die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit von Conquista und Kolonisierung, der sich in einer Vorlesung mit dem Titel De indis nuper inventis (1539) findet, die im Kern die fundamentale Frage des Völkerrechts (ius inter gentes) behandelt. Darin wirft er die Frage auf, mit welchem Recht (quo jure) die Spanier eine Kolonialherrschaft ausüben dürften und weist argumentativ nach, dass die Indios legitime Herrschafts- und Eigentumsrechte ausübten. Vor diesem Hintergrund erörtert er die legitimen und illegitimen Rechtstitel spanischer Kolonialherrschaft und plädiert für symmetrische Beziehungen zwischen den Völkern, die jeden Kolonialismus verbieten, aber legitime Rechte wie freizügiges Reisen (peregrinatio), Handel (negotio) sowie Mission (predicatio) bejahen.11 Noch heute werden die Thesen der "Schule von Salamanca" diskutiert. Dabei verkennt Vitoria aber, dass es de facto keine Symmetrie zwischen den Indios und den Spaniern gab, denn diese traten in der Neuen Welt in der Regel nicht als friedliche Migranten oder Händler (peregrini) auf, sondern als Eroberer oder Invasoren.
Ähnlich wie Vitoria argumentiert ein Schreiben von Papst Paul III. (1468–1549) in der Bulle Sublimis Deus vom 2. Juni 1537, dass "die Indios ihrer Freiheit und ihres Besitzes nicht beraubt werden dürfen; vielmehr sollen sie ungehindert und erlaubterweise das Recht auf Besitz und Freiheit ausüben … Auch ist es nicht erlaubt, sie in den Sklavenstand zu versetzen. Alles, was diesen Bestimmungen zuwiderläuft, sei null und nichtig."12 Im Rahmen des Patronats untersagte die Krone zwar die Veröffentlichung, gleichwohl war das Schreiben den indiofreundlichen Missionaren bekannt.
Auch das in vielen Auflagen erschienene Missionshandbuch De procuranda indorum salute (1588)
Späte Kolonialkritik
Eine wertvolle Quelle kolonialer Kritik aus indianischer und christlicher Perspektive bietet Felipe Guamán Poma de Ayala (ca. 1550–1615), der im Andenraum eine 1.200 Seiten starke, mehrsprachige "Chronik" verfasste und mit zahlreichen Federzeichnungen illustrierte. Sie beinhaltet Geschichte und Kultur der Inka, amalgamiert mit der Geschichte des Christentums und Europas in Amerika. Mit diesem Riesenwerk El primer Nueva Corónica y Buen Gobierno lenkte er den Blick auf sein Land, beschrieb aber auch krasse Missstände der kolonialen Institutionen in Wort und Bild, um den spanischen König (Philipp III. 1578–1621) zu Gerechtigkeit und guter Regierung zu bewegen. Eine der Zeichnungen zeigt einen "Armen Indio" (pobre de los indios), der von sechs Tieren bedroht wird, die als Metaphern für die Kolonialgewalt stehen
Ebenfalls am Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden in Paraguay die sogenannten "Reduktionen" (reducción), eine missionspraktische Alternative zum Kolonialsystem. In diesem Projekt der Jesuiten, das die Franziskaner Mexikos bereits im 16. Jahrhundert praktiziert hatten, siedelte man die nomadisierenden Guaraní und andere Völker in Ortschaften an, getrennt von der Kolonialgesellschaft. Dort existierte eine gewisse Selbständigkeit, so dass bisweilen von einem "Jesuitenstaat" die Rede ist, doch blieben die Gebiete ins spanische Kolonialreich inkorporiert. Im Lauf der Zeit entstanden 30 Reduktionen mit etwa 140.000 indianischen Einwohnern, die unter Anleitung weniger Missionare auf den Gebieten der Wirtschaft (Landwirtschaft, Viehzucht), des Handwerks, der Kunst, der Architektur und der Musik (Polyphonie) eine hybride christlich-indigene Kultur ausbildeten. Mit der Vertreibung des Jesuitenordens (1767) aus Amerika und seiner Auslöschung (1773) endete das Projekt. Es dürfte der paradoxe Versuch gewesen sein, im Rahmen eines Kolonialreiches kontrafaktisch ein einzigartiges Gemeinwesen zu schaffen, in dem Bartomeu Melià (1932-2019) zufolge eine christliche Utopie ihren Ort fand.14
In der Umbruchszeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts bahnte sich im Zuge revolutionärer Wirren und Unabhängigkeitsbestrebungen die Dekolonisation zu Beginn des 19. Jahrhunderts an, unter maßgeblicher Beteiligung des "Libertador" Südamerikas, Simón Bolívar (1783–1830) [
Die aufgezeigten verschiedenen Perspektiven unterstreichen, welche philosophisch-ethischen, theologisch-spirituell und pastoral-praktischen Bemühungen, oft erfolglos, unternommen wurden, um das koloniale System zu verändern und die religiöse Eigenlogik der Glaubensverbreitung zu sichern. Dies geschah, obwohl nicht wenige Kirchenleute am kolonialen Status quo interessiert waren.
Asien
Im asiatischen Raum mit seinen zahlreichen Kulturen begegnete die christliche Glaubensverbreitung völlig anderen Kontexten. Es war der Raum, in dem die Portugiesen ihre Stützpunkte einrichteten, wie etwa 1510 die Enklave Goa. Diese entwickelte sich zur Drehscheibe für den Handel und zum kirchlichen Zentrum Asiens. Mit den Stützpunkten in Goa, Macao und anderen Orten schuf sich Portugal einen Estado da Índia mit kolonialen Enklaven. In Asien unterstanden der kirchliche Apparat und die Mission dem Padroado.
In diesem portugiesisch dominierten Raum bildete der von Fernando Magellán (1480–1521) während der Weltumseglung entdeckte Archipel, der später Philippinen genannt wurde, einen Sonderfall, da er von Spanien beansprucht wurde. Der den Pazifik überquerende Miguel López Legazpi (ca. 1510–1572) begann ab 1565 mit der Kolonisierung, die sich jedoch auf eine friedliche Christianisierung durch Ordensleute, am Anfang besonders die Augustiner, Dominikaner und Franziskaner, stützte. Manila wurde zur Hauptstadt und zum Sitz der Erzdiözese. Eine Handelsroute über den Pazifik verband die Galeone von Manila nach Acapulco. 1898 erlangten die Philippinen die Unabhängigkeit, die ihnen die USA bis 1946 wieder nahmen. Heute sind die Philippinen das einzige Land in Asien, das weitgehend katholisch geprägt ist (ca. 80 Prozent), mit muslimischer Minorität.16 Die Philippinen und Lateinamerika zeigen, dass die Mission im Schatten des spanischen patronato oder des portugiesischen padroado katholisch geprägte Nationen mit dem entsprechenden Wertewandel hinterlassen hat, während dies der römischen Kongregation seit 1622 in ihrem Wirkungsbereich in Asien und Afrika trotz ihrer Inkulturationsprogrammatik nicht gelungen ist. Dies ist ein paradoxer Befund. Im asiatischen Großraum gehörten zu den missionarisch bedeutsamen Ländern vor allem Indien, Japan, China, Korea, Vietnam17 und Siam (Thailand).
Indischer Subkontinent
Nachdem der Entdecker Vasco da Gama (1469–1524) erstmals 1498 Calicut in Indien erreicht
Der erste weit vorausschauende Missionar Indiens war Francisco Javier oder Franz Xaver (1506–1552)[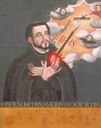

Auf dem Subkontinent gab es Missionsprojekte neuer Art, die die vorherrschenden kulturellen Kontexte stärker miteinbezogen. Ein Projekt dieser Art entstand im nördlichen Mogul-Reich,20 wo Akbar der Große (1542–1605) erstmals Jesuiten aus Goa zu Religionsgesprächen an den Hof einlud
Ein weiteres Projekt entstand in der alten südindischen Stadt Madurai mit einem enormen hinduistischen Tempelkomplex. Hier begann der junge Missionar Roberto de Nobili (1577–1656), der dem römischem Stadtadel entstammte, mit der Anpassung der Mission an die fremde Kultur, ähnlich wie es bereits vorher in Japan versucht worden war. Er studierte Sanskrit sowie die Landessprache Tamil und nahm die Lebensweise eines asketischen (christlichen) "Sannyasin" an. Äußerlich erkennbar am safranfarbenen Gewand, an Schnur und am Haarzopf, war der Preis einer solchen Lebensweise die Einordnung in die Kastenstruktur. In einem Brief an Papst Paul V. (1552–1621) bezeichnet er sich 1619 als "italienischen Brahmanen".22 Tatsächlich gelangen ihm missionarische Erfolge unter den Brahmanen. Zwar tolerierte Rom zunächst diesen extravaganten Weg, doch ein Jahrhundert später sollte Rom 1744 die "malabarischen Riten" untersagen. Der Versuch, das Evangelium im Kontext einer hinduistischen Kastengesellschaft zu verbreiten, führte jedoch zu wechselseitigem Verständnis und Respekt vor den jeweiligen kulturellen und religiösen Eigenarten.23
Wenig später kam es zu protestantischen Missionstätigkeiten im kolonialen Kontext. Mit der wachsenden Stärke der protestantischen Seemächte im asiatischen Raum gründete auch der dänische König Frederik IV. (1671–1730) im südindischen Tranquebar eine Handelskolonie. Dafür suchte er protestantische Missionare, die er im Halleschen Pietismus fand. So kam es 1706 zur Entsendung der deutschen Missionare Bartholomäus Ziegenbalg (1682–1719)[
Ferner Osten Japan
Mit Hilfe weiterer Missionare entwickelte sich eine blühende Periode der Christianisierung Japans (Kirishitan), die allerdings durch Verfolgung nur ein knappes Jahrhundert andauerte. Zur Missionsarbeit gehörten Religionsgespräche mit buddhistischen Schulen (1550), aber auch freundliche Kontakte zu Feudalherren (Daimyos) wie Ōtomo Sōrin Yoshishige (1530–1587) von Bungo, der den christlichen Glauben annahm. Das Vorbild solcher Lokalfürsten, die sich für die Religion und die Wissenschaft des Westens interessierten, führte auch zu wachsendem Interesse im Volk und zu Massentaufen.
Das Missionsprojekt im nicht-kolonialen Kontext verursachte erhebliche Kosten, so dass die Missionare zur Finanzierung Handelsaktivitäten aufnahmen, bei denen portugiesische und niederländische Händler rivalisierten. Nicht zuletzt rangen die Orden um die angemessene Missionsmethode. Dabei gelang es dem Italiener Alessandro Valignano (1539–1606) als Visitator der Jesuiten, einen nachhaltigen Paradigmenwechsel einzuleiten, an dem europäische Missionare und ihre japanischen Mitarbeiter (dōjoku) mitwirkten und Kirchengebäude, Schulen, Seminare, Malschulen sowie eine Druckerei entstanden.24
Die neue Methode der "Akkommodation" passte sich hinsichtlich von Sprache, Kleidung und Gebräuchen so weit wie möglich an die einheimische Kultur an. Ab 1580 reiste Valignano mehrfach nach Japan, um dieses neue Modell zu implementieren. Schließlich wurde die Zahl der Christen im Land auf etwa 300.000 geschätzt. Die Religionspolitik änderte sich jedoch, als nach einer christenfreundlichen Periode unter Hideyoshi Toyotomi (1537–1598) Christen mit grausamen Strafen bis hin zu Kreuzigungen verfolgt wurden

Kaiserreich China
Erst drei Jahrzehnte nach Xavers Tod gelang es den ersten Jesuiten, 1580 von Macao aus in das Reich der Mitte zu gelangen. Es herrschte Kaiser Wanli, Ming Shenzong, (1563–1620) der Ming-Dynastie, der das Land nach Westen öffnete. Zu den ersten Pionieren dieses Missionsprojekts gehörte der Italiener Matteo Ricci (1552–1610).25 Er genoss schon den Ruf eines Gelehrten aus dem Westen, was schließlich 1601 zur Gründung einer Niederlassung in Peking führte. Dabei setzte Ricci auf Gespräch, Freundschaft und wissenschaftlichen Austausch mit konfuzianischen literati, etwa mit dem Staatsmann und Gelehrten Xu Guangqi (1562–1633), der später den christlichen Glauben annahm
Auch weitere bedeutende Missionare gehörten zu den Jesuiten in China, wie der Rheinländer Johann Adam Schall von Bell (1592–1666)[
Der jesuitischen Methode liegen vier Grundätze zugrunde: Erstens die Anpassung an den kulturellen Kontext; zweitens soll die Evangelisierung möglichst "von oben" (top down) erfolgen, d.h. bei den politischen und intellektuellen Eliten ansetzen; drittens geht es um den Gebrauch der Wissenschaften im Prozess der Mission; viertens gilt das Prinzip der Toleranz, konkret gegenüber den konfuzianischen "Riten" ziviler, nicht-religiöser Art. Beispielsweise wurden als Ausdruck der Pietät vor Eltern und Ahnen sowie vor Konfuzius Räucherstäbchen entzündet. Beim "Ritenstreit" ging es generell um die Frage missionarischer Anpassung an die Kultur (Akkomodation) und im konkreten Fall um die Einschätzung der rituellen Verehrung der Ahnen und des Konfuzius. Die Jesuiten vertraten die Ansicht, dass es sich um zivile Riten handelt, die toleriert werden können. Anderer Meinung waren die Mendikanten der Dominikaner und Franziskaner, die ab 1630 von den spanisch beherrschten Philippinen nach China gekommen waren und den Riten einen religiösen Charakter zuschrieben. Auch die Methoden unterschieden sich: Begannen die Bettelorden mit einer direkten Predigt des Kreuzes im Ordenshabit, traten die Jesuiten dagegen im seidenen Gelehrtengewand auf, begannen ihre Tätigkeit indirekt mit Wissenschaften sowie Moralphilosophie und setzten auf die paulinische Areopag-Methode vom "unbekannten" und doch "nicht fernen Gott" (Apostelgeschichte 17, 23 und 27). So entstanden Differenzen und Rivalitäten zwischen den Orden, die durch den Gang beider Kontrahenten nach Rom verstärkt wurden. Dazu kam auf kirchenpolitischer Ebene der schwelende Konflikt zwischen dem portugiesischen Padroado und der römischen Propaganda-Kongregation. Überdies bekamen in Rom beide Parteien Recht: die Progaganda gab den Dominikanern Recht, die Riten seien religiöser Natur (1645), während die Glaubenskongregation die Position der Jesuiten vom zivilen Charakter der Riten unterstützte (1656). Zwar vermochten die Jesuiten es mit ihren diplomatischen und staatspolitischen Erfolgen (Kalenderreform) das Toleranzedikt des Kaisers Kangxi, Qing Shengzu, (1654–1722) von 1692 zu erwirken, das die christliche Mission im ganzen Reich gestattete. Doch diese Periode endete schnell, da Papst Clemens XI. (1649–1721) ein Verbot der Riten aussprach (1704) und überdies der Päpstliche Legat Maillard de Tournon (1668–1710) in der Audienz mit dem Kaiser so unglücklich agierte, dass es zur Ausweisung der Missionare kam.
Damit war das Schicksal der chinesischen Mission besiegelt. Doch lässt dieses Vorgehen erkennen, wie wissenschaftlicher Austausch und Diskurse über normative philosophische und religiöse Fragen bei beiden Interaktionspartnern erhebliche Wandlungs- und Transferprozesse in Gang brachten: europäische Wissenschaft nach China, chinesische Weisheit des Konfuzius nach Europa. Europäische Kolonialismusbestrebungen konnten in der Frühen Neuzeit im mächtigen Reich der Mitte nicht verfangen, wohl aber in dessen Schwächephase im 19./20. Jahrhundert.
Afrika
Im 18. Jahrhundert erlebte die Mission der katholischen Kirche einen deutlichen Einbruch, der auf äußere und innere Gründe zurückzuführen ist. Politisch verschoben sich die Machtzentren von den iberischen (katholischen) zu den protestantischen Seemächten Niederlande und Großbritannien. Die Französische Revolution forderte ihren Tribut in Sachen Religion, ebenso die napoleonische Politik und die Säkularisation. Die Aufklärung, auch der deutsche Idealismus, bescheinigte dem südlichen Kontinent Amerika und dem subsaharischen Afrika "Inferiorität". Dazu kamen kirchenpolitische Spannungen wie der Ritenstreit in China und Indien sowie die Deportation der Jesuiten aus Übersee und die Aufhebung des Ordens durch Papst Clemens XIV. (1705–1774) 1773, ein Aderlass, der Tausende von Missionaren betraf.
Ende des 18. Jahrhunderts gab es eine neue Entwicklung: in Korea etablierte sich das Christentum ohne den direkten Einfluss europäischer Missionare, auf Initiative des koreanischen Intellektuellen Yi Seung-hun (1756–1801). Er hatte den christlichen Glauben in Peking kennengelernt und 1784 nach Korea gebracht, wo er sich trotz Verfolgung ausbreitete.29 Anfang des 19. Jahrhundert begannen zudem neue missionarische Unternehmungen in Afrika.
Neuaufbruch in Afrika
Auf dem afrikanischen Kontinent hatte sich das Christentum seit der Antike ausgebreitet: Das westliche Christentum in Nordafrika bis zur Eroberung durch den Islam (759); das koptische Christentum in Ägypten (später auch in Nubien) und in Äthiopien. In der Frühen Neuzeit kam die neue Christianisierung des Kongo-Reichs

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts kam es zu einem neuen Aufschwung der Mission, ausgelöst durch ein wachsendes Interesse am Katholizismus und seiner Formensprache, sei es im Volk oder in geistigen Strömungen wie der Romantik. Nicht mehr Fürsten oder Bischöfe waren Initiatoren und Financiers der Mission, sondern katholische Laien, Männer, Frauen und Kinder, die sich die Sache der Glaubensverbreitung zu Eigen machten. Lange vor dem Kolonialismus in Afrika entwickelten sich in der ersten Hälfte des Jahrhunderts Laien-Bewegungen, deren Zentrum Frankreich war. Dort entstand auf Initiative der jungen Marie-Pauline Jaricot (1799–1862) ein nationaler Verein für die Verbreitung des Glaubens (Association de la Propagation de la Foi) (1822). Schnell folgte Deutschland mit dem von dem Aachener Arzt Heinrich Hahn (1800–1882) gegründeten Franziskus-Xaverius-Verein (1832), und dem in Bayern entstandenen König-Ludwig-Missionsverein (1838), aus denen die heutigen kirchlichen Hilfswerke hervorgingen. Solche internationalen Missionsvereine unterstützten die auswärtigen Missionen spirituell und finanziell. Auch zahlreiche Medien wie Missionszeitschrift entstanden; in Deutschland etwa ab 1878 Die katholischen Missionen (heute: Forum Weltkirche).
Akteure
Träger der internationalen Missionsarbeit im 19. Jahrhundert waren zahlreiche Missionsgesellschaften und -institute wie die Pariser Missionsgesellschaft (Société des Missions Etrangères de Paris), die nach der Französischen Revolution 1803 entstanden war. Weitere Gründungen wie etwa in Italien (Istituto Missioni Estere) oder England (Mill-Hill) vervollständigten das Bild. Die neue Gründung der italienischen Comboni-Missionare (1867) konzentrierte sich auf Afrika, wie auch der Société des Missionnaires d'Afrique, die der Franzose Charles Lavigerie (1825–1892)[
Einen nachhaltigen Kulturwandel bewirkten Ordensschwestern und Missionarinnen, die der Mission ein weibliches Gesicht verliehen. Von den zahlreichen neuen weiblichen Kongregationen sei Anne-Marie Javouhey (1779–1851) genannt, welche 1807 die Soeurs de Saint-Joseph de Cluny gründete. Sie entsandte wenig später Missionsschwestern, wirkte selbst im Senegal und trat für die Sklavenbefreiung ein. Oftmals gründeten die Missionsorden neben einem männlichen auch einen weiblichen Zweig, wie die Soeurs Missionnaires de Nortre Dame d'Afrique (1869). Mission, Katechese, Bildung und Gesundheitswesen entwickelten sich zu zentralen Arbeitsfeldern.31 Am Ende des 19. Jahrhunderts wies die Missionsstatistik der katholischen Kirche beeindruckende Zahlen der missionarischen Akteure (Ordensmänner und -frauen) in Afrika auf. Man zählte über acht Millionen Gläubige, protestantische Denominationen etwa fünf Millionen.32 Die Zahl afrikanischer Ordensfrauen stieg im 19. und 20. Jahrhundert stetig an, ebenso die Zahl einheimischer Schwesternkongregationen.
Die Missionierung Afrikas im 19. Jahrhundert beruhte auf Parallelaktionen der Konfessionen, bei der die Katholische Kirche und die protestantischen Denominationen in Konkurrenz zueinander agierten. Protestantische Missionsgesellschaften waren nicht selten auf Afrika oder andere Länder wie China spezialisiert. Eine bedeutende Rolle für Afrika spielten etwa die London Missionary Society (LMS, 1795, 1818), die Basler Mission (1815) sowie die französische Société de Missions évangéliques (1822).33
Die Vielzahl der katholischen Institutionen fanden durch Apostolische Vikare und die römische Congregation de Propaganda fide eine gesamtkirchliche Einheit. Im protestantischen Raum trat erstmals 1910 die Welt-Missions-Konferenz in Edinburgh zusammen, aus der 1948 in Genf der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) hervorging.
Kolonialismus und Dekolonisation
Über den missionarischen Aufbruch im 19. Jahrhundert legte sich freilich mit dem Kolonialismus der europäischen Mächte ein tiefer Schatten über den schwarzen Kontinent. So wurde nolens volens auch die Mission in diesen Sog hineingezogen, nolens, weil die religiöse Logik in Misskredit geriet, volens, weil Mission und Kolonialverwaltung oft einträchtig bis hin zu Zweckbündnissen zusammenarbeiteten und beide als gemeinsames Ziel die "Zivilisierung" der Afrikaner betonten.34
Nach der Durchdringung des afrikanischen Kontinents kam es um 1880 zum Wettlauf der europäischen Mächte um Afrika ("scramble for Africa"), der eine fast restlose politische Aufteilung (außer Äthiopien) unter europäische Nationen zur Folge hatte. In dieser imperialistischen Epoche waren vor allem Großbritannien und Frankreich die Nutznießer, aber auch Belgien, Deutschland, Italien, Portugal und Spanien. Das Deutsche Reich übernahm als "Schutzgebiete" Togo 
Die willkürlichen Grenzen, welche die Ethnien durchkreuzten, wurden von den Signatarmächten der Berliner Kongo-Konferenz (1884/85) gezogen. Deren General-Akte lässt in Artikel 6 deutlich die enge Verbindung von Kolonialherrschaft und Mission erkennen. Darin verpflichten sich die Mächte neben der effektiven Besitzergreifung, "die Erhaltung der eingeborenen Bevölkerung, die Verbesserung ihrer sittlichen und materiellen Lebenslage zu überwachen" … und den Eingeborenen "die Vortheile der Civilisation verständlich und werth zu machen."35 Bei der Berliner Konferenz waren keine "Eingeborenen" zugegen.
Das war nicht zuletzt dem Zeitgeist geschuldet, der Europäismus und Superioritätsgefühl mit Nationalismus verband. Der Kolonialismus überdauerte den Ersten Weltkrieg, in dem die Sieger die Kolonien des Kriegsverlierers übernahmen und die deutschen Missionare zurückkehren mussten. Die Kolonien verschwanden erst im Zuge der Dekolonisationen ab Mitte des 20. Jahrhunderts. Bildung und Erziehung in den Missionsschulen dürften zu den Prozessen der Emanzipation und der Unabhängigkeitsbewegungen beigetragen haben.36
Kultur- und Wertewandel
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis (Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen) lautet ein neuzeitliches Sprichwort, das die Momente des Wandels zum Ausdruck bringt, die ubiquitär jede Zeitspanne aufs Neue prägen. Die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlich und reichen von natürlichen bis zu kultürlichen, welche die schöpferischen Fähigkeiten der Menschen, die Kulturen jeder Art hervorbringen. Ein sehr spezieller Kultur- und Wertewandel ist eng mit der missionarischen Ausbreitung des christlichen Glaubens verbunden. Solche Wandlungsprozesse fanden im Zuge seiner Globalisierung statt, vor allem seit den frühneuzeitlichen Kulturkontakten in Amerika und Asien, in denen Mission einen "gelenkten Kulturwandel" durch Akkulturation und damit auch einen Wertewandel mit sich brachte.37
Wie solche Prozesse verliefen, hing von zahlreichen Faktoren ab, vor allem aber von den jeweiligen Kulturen. Doch auf welche Kulturen Missionare auch immer stießen, sie brachten, eingebettet in ihre eigene Kultur, die religiöse Botschaft des Christentums in anderen Kulturen zur Sprache, was dort zu einem kulturellen Wertewandel führen konnte. Nützliche kulturelle Elemente, welche die anderen Kulturen bereicherten, fanden schnell Eingang, ob es wirtschaftliche Innovationen, Siedlungsbau, Viehzucht oder die Übernahme der (lateinischen) Schrift in Amerika waren, mathematische Theorien oder technologische Innovationen in China. Manche Eingriffe in die Sprache erwiesen sich bisweilen als hilfreich und nachhaltig, wie die Umwandlung der (chinesischen) Schrift Vietnams in die lateinische Schrift mit diakritischen Zeichen, die Alexandre de Rhodes (1593–1660) vornahm.38 Normative Innovationen wie der Übergang von der Polygamie zur Monogamie brauchten mehr Zeit zur Akzeptanz. Am schwierigsten aber war es, ins Herz einer Kultur vorzudringen oder in den Bereich religiöser Überzeugungen. Das gilt auch wechselseitig für die umgekehrten Prozesse, wenn Elemente anderer Kulturen in die eigene übernommen werden, ob es sich um Xocolatl, die südamerikanische Chinarinde
Der Werte- und Kulturwandel im Rahmen christlicher Mission bezieht sich auf fast alle kulturellen Bereiche, so auf das Gemeinwesen (Politik), die Sprache ("Übersetzung"), die normativen Systeme (Moral, Recht und Religion), auf Wirtschaftsleben, Gesundheit und Bildung, Wissen, Kunst und nicht zuletzt auf philosophische Fragen. Das würde sich zeigen, wenn man die missionarischen Projekte einzeln durchkämmen würde. Hier bleibt nur Platz für einen Hinweis, wie es gelingen kann, über äußere Akkomodation hinaus, ins Herz vorzudringen und resonante Beziehungen auf Augenhöhe zu etablieren. Es handelt sich exemplarisch um das freundschaftliche Verhältnis des italienischen Missionars und Gelehrten Matteo Ricci (1552–1610) mit dem chinesischen Staatsmann und Gelehrten Xu Guangqi (1562–1633), die wissenschaftlich eng zusammenarbeiteten. Riccis erstes auf Chinesisch verfasstes Buch beinhaltet einhundert europäische Sentenzen von der Freundschaft; damit aber knüpfte er an die fünf konfuzianischen Sozialbeziehungen an, von denen vier Abhängigkeitsverhältnisse wie älterer und jüngerer Bruder darstellen, aber nur eine frei wählbare Sozialbeziehung, nämlich die Freundschaft, die den Kern, das personale Innere trifft und beide verwandelt.39
Ausblick
Nach dem Ersten Weltkrieg kam es in der katholischen Mission zu einem einschneidenden Paradigmenwechsel gegenüber der herrschenden Kolonialpolitik. Papst Benedikt XV. (1854–1922) veröffentlichte das Schreiben Maximum illud vom 30. Nov. 1919, das neue kirchenpolitische Grundlagen schuf. Zum einen setzte es sich scharf vom Kolonialismus und Nationalismus der Zeit ab und verurteilte die unheilige Allianz zwischen Kolonialherrschaft und Mission. Auf der anderen Seite plädierte es für einen autochthonen Klerus und für eine stärkere Beteiligung von Frauen an der Missionstätigkeit.40 Damit brach kirchlich, Jahrzehnte vor den Dekolonisationen, eine neue Ära an, die Hoffnung auf "neue Kirchen" setzte.41 Die damit eingeleitete Entwicklung führte in der Mitte des 20. Jahrhunderts zur politischen Dekolonisierung.
Kurz danach fand auf kirchlicher Ebene das Zweite Vatikanische Konzil (1963–1965) statt, auf dem sich die katholische Kirche als Weltkirche konstituierte. Erstmals waren auch afrikanische Bischöfe vertreten. Zum einen ordnete die katholische Kirche ihr Verhältnis zur Moderne neu, zum anderen modernisierte sie ihr Verständnis von Mission. Mit der Dekolonisierung setzte also keineswegs eine "Demissionierung" ein, wohl aber ein Wechsel der Richtungen, die nicht mehr von Europa nach Übersee, sondern von Indien und Afrika in alle Welt verlaufen. Dazu kommt der Wandel des Missionsverständnisses hin zur Evangelisierung und zu den normativen konziliaren Grundlagen: die Erklärung über die Religionsfreiheit (Dignitatis humanae), die Erklärung über das Verhältnis zu den nicht-christlichen Religionen (Nostra aetate) und das Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche (Ad gentes); dazu kommen die theologischen Grundlagen der beiden Konstitutionen über die Kirche (Lumen gentium) und über die Kirche in der Welt von heute (Gaudium et spes).42
Seitdem haben sich – auch ökumenisch – weltweit die Leitworte der Inkulturation, des interreligiösen Dialogs und der Anerkennung des Anderen durchgesetzt. In der Gegenwart versteht sich die bleibende Aufgabe der Verbreitung des christlichen Glaubens als missionarische und geistliche "Evangelisierung".43 Heute zählt die Katholische Weltkirche rund 1,3 Milliarden Mitglieder, mit steigender Tendenz.






