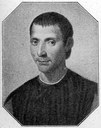Antike und ihre Aneignung – Ein Problemaufriss
"Quid est enim aliud omnis historia, quam Romana laus?"1 Als Francesco Petrarca (1304–1374) diese Frage aufwarf, brachte er die Stimmung des frühen italienischen Humanismus zum Ausdruck. Die Wiederentdeckung der Antike und die Abkehr von den "tenebrae" (der "Dunkelheit") des "medium tempus" ("Mittelalter") wurde zum Programm der Renaissance2 und steht am Beginn der Epoche, die seit der endgültigen Dreiteilung der Geschichte durch Christoph Cellarius (1638–1707) in seiner Historia Universalis als Neuzeit bezeichnet wird.3 Überspitzt könnte man formulieren: Die Neuzeit definierte sich über die Antike, und ohne einen Bezug auf das Modell Antike gäbe es keine Neuzeit.
Doch was heißt "Modell Antike"? Wie können die Rezeptions- und Transferprozesse, die dem Begriff zugrunde liegen, angemessen beschrieben werden?4 Beschreibungsmöglichkeiten liefern die Ansätze der Rezeptionsästhetik. Das Ziel dieser vor allem literaturwissenschaftlichen Perspektive ist es, vom Werk weg auf den Leser und Rezipienten zu fokussieren und dessen Wahrnehmung und Aneignung von Kunstwerken in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken.5 In durchaus ähnlicher Weise fragt auch die neuere Kulturtransferforschung nicht mehr primär nach den Kulturemen einer Ausgangskultur, sondern sie geht davon aus, dass Übernahmen aus Aneignungsbedürfnissen resultieren und diese die Form der Anverwandlung bestimmen.6
Antike, so kann man analog formulieren, wird in unterschiedlichen Situationen in einem reziproken und dynamischen Sinne angeeignet. Sie fungiert jedoch als Modell, als Konstrukt von Vergangenheit, und unter Bezugnahme auf gegenwärtige Realität. Dennoch ist den jeweiligen Akteuren die Konstruktivität der Übernahme nicht immer bewusst. Vielmehr wirkt die Modellbildung zurück, sie schafft vergangene Wirklichkeit neu und modifiziert somit Wissensbestände. Wir sprechen daher von einer "Aneignung" und "Verargumentierung", die die in Text, Bild und materieller Hinterlassenschaft höchstens fragmentarisch verfügbare Antike den jeweiligen Argumentationsbedürfnissen anpasst, so dass "hybride" Formen entstehen.7 Die "Situationen", in denen Antike mit jeweils neuer Bedeutung aufgeladen wird, bezeichnen wir daher als "Aneignungssituationen", so dass die "Momente der Konstituierung" und das "Neben- und Gegeneinander verschiedener, gleichzeitig abrufbarer Verwendungen" in den Blickpunkt rücken.8 Aneignung wird also eingebettet in ihre spezifischen Kontexte; modellhaft ist sie, weil sie in der politischen Debatte normative und vorbildhafte Funktionen erfüllt.
Freilich geschieht die Aneignung eines Modells nicht allein durch direkten Rückbezug auf Antike, sondern ist stets mitgeprägt von früheren Aneignungsvorgängen. Vorangegangene Interpretationen von Antike liegen als Traditionskerne zwischen der jeweiligen Gegenwart und der Antike, prägen somit Lesarten vor und verhindern, ohne dass die Rezipienten dies immer erkennen, einen direkten Zugriff auf die antiken Texte. Diese Traditionskerne werden in zeitgenössischen Vorstellungen von Antike verargumentiert und bilden gleichsam Folien, die die Antike für die jeweilige Gegenwart lesbar und interpretierbar machen. Dabei werden an die antiken Traditionskerne "Layer" angefügt, die nicht nur durch die jeweiligen gegenwärtigen Diskurse, sondern auch durch soziale und politische Spezifika sowie durch die Eigentümlichkeiten des jeweiligen Genres definiert werden, in dem sie auftauchen.9
Antike, so muss wohl festgehalten werden, ist ebenso wie die Vergangenheit an sich prinzipiell unverfügbar. Sie kann nur durch zahlreiche Schichten der Rezeption und Aneignung hindurch verstanden und erneut angeeignet werden. Als Modell wird sie also stets neu mit Inhalt gefüllt und stellt immer neue Repräsentationen antiker Tatsachen dar, die gleichwohl in Form kultureller Codes die gesamte Frühe Neuzeit hindurch und bis weit in die Neueste Geschichte hinein paradigmatische Bedeutung besaßen – trotz der im späten 17. Jahrhundert teils erbittert geführten Querelle des Anciens et des Modernes.10 Generell war Rom als Referenzpunkt insbesondere in der politischen Geschichte präsenter als Griechenland, obwohl der Philhellenismus eine äußerst wirkmächtige geistesgeschichtliche und politisch wirksame Bewegung darstellte.11
Das Modell Antike und die Reichsidee seit dem Mittelalter
Von besonderer Bedeutung war die Antike (und hier insbesondere Rom) zweifellos, wenn es um den universalen Anspruch von Herrschaft ging. Für die Reichsidee war die Vorstellung von tragender Bedeutung, dass im römisch-deutschen Kaisertum das römische Kaiserreich fortlebte. Rom war mithin sowohl für die weltliche als auch für die geistliche Universalmacht ein Referenzrahmen, der letztlich von 800 bis 1806 unter vielfältigen zeitbedingten Anpassungen Bestand haben sollte. Eine wesentliche Rolle spielte dabei auch die eschatologische Funktion Roms, galt Rom doch als die letzte der vier Weltmonarchien vor dem Anbruch des Jüngsten Gerichts.12 Aufgrund der Anknüpfung an die römischen Imperatoren in Mittelalter und Neuzeit13 werden die Herrscher Roms im Deutschen als Kaiser bezeichnet, was eine eigentlich nicht treffende Etikettierung ist.14
Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts trat hierzu die Idee einer translatio imperii, also einer "Übertragung des Reichs" auf die Franken,15 und die Bezeichnung Sacrum Imperium Romanum ("Heiliges Römisches Reich") blieb bis zum Ende des Alten Reiches von Bedeutung, sicherte doch die behauptete Kontinuität der Kaiser von der Antike bis in die Neuzeit dem Alten Reich die vornehmste Stellung in Europa.16 Zur Herleitung politischer oder rechtlicher Positionen diente indes die Bezeichnung "Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation" nicht mehr,17 vielmehr wurde durch sie die untrennbare Zusammengehörigkeit von Römischem Reich und deutscher Nation zum Ausdruck gebracht.18
Auch wenn die Rom-Idee damit immer weiter verblasste, blieb sie doch unverzichtbarer Bestandteil herrschaftlicher Selbstdarstellung, wie sich etwa an der Grabinschrift Maximilians I. (1459–1519) auf dem Kenotaph in der Hofkirche in Innsbruck ablesen lässt. Seine dort verwendete Titulatur bildet einen direkten Bezug auf die Herrscher des alten Rom: IMPERATORI CAES(ARI) MAXIMILIANO PIO FOELICI | AUG(USTO) PRINCIPI.19 Selbiges gilt auch noch im 18. Jahrhundert, etwa für die Selbstdarstellung Josephs II. (1741–1790) und Maria Theresias (1717–1780), wie das Beispiel der Triumphpforte in Innsbruck eindrücklich zeigt. Der römische Bautypus des Triumphbogens wurde seinem eigentlichen militärischen Kontext entnommen und 1765 anlässlich der Hochzeit Erzherzog Leopolds (später Kaiser Leopold II., 1747–1792) mit der spanischen Prinzessin Maria Ludovica (1745–1792) erbaut. Die Inschriften von Leopolds Bruder, dem späteren Joseph II., und seiner Mutter Maria Theresia an der Triumphpforte stellen wiederum eine bewusste Anknüpfung an römische Kaisertitulaturen dar: IMP(ERATOR) CAES(AR) | IOSEPHUS II | AUGUSTUS bzw. M(ARIA) THERESIA | AUGUSTA. Obgleich die politische Bedeutung eher gering war, war die Rom-Idee für die Selbstdarstellung und für den eindringlich behaupteten Vorrang des Kaisers des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation weiterhin von besonderer Wichtigkeit, wurde dabei freilich an die Bedürfnisse der Zeit angepasst.
in Innsbruck eindrücklich zeigt. Der römische Bautypus des Triumphbogens wurde seinem eigentlichen militärischen Kontext entnommen und 1765 anlässlich der Hochzeit Erzherzog Leopolds (später Kaiser Leopold II., 1747–1792) mit der spanischen Prinzessin Maria Ludovica (1745–1792) erbaut. Die Inschriften von Leopolds Bruder, dem späteren Joseph II., und seiner Mutter Maria Theresia an der Triumphpforte stellen wiederum eine bewusste Anknüpfung an römische Kaisertitulaturen dar: IMP(ERATOR) CAES(AR) | IOSEPHUS II | AUGUSTUS bzw. M(ARIA) THERESIA | AUGUSTA. Obgleich die politische Bedeutung eher gering war, war die Rom-Idee für die Selbstdarstellung und für den eindringlich behaupteten Vorrang des Kaisers des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation weiterhin von besonderer Wichtigkeit, wurde dabei freilich an die Bedürfnisse der Zeit angepasst.
Auch die Könige Frankreichs verzichteten nicht darauf, Bezüge zur römischen Kaiserwürde herzustellen, insbesondere wenn es darum ging, Ansprüche auf die Kaiserkrone zu untermauern. Ein "neues Rom" sollte unter Franz I. (1494–1547) in Frankreich entstehen, was beispielsweise durch zahlreiche architektonische und dekorative Antikenzitate in der Grande Galerie von Schloss Fontainebleau zum Ausdruck kommt.20 Unter Heinrich IV. (1553–1610) und Ludwig XIV. (1638–1715) erreichten solche imperialen Gesten, die sich gezielt des Modells Antike bedienten, erneute Höhepunkte.21
In England wiederum spielte seit dem Beginn der Regierung Karls II. (1630–1685) im Jahre 1660 die Idee eines Augustan Age eine wichtige Rolle. Das Verständnis dieses neuen Augusteischen Zeitalters war zweifellos vielfältig, doch neben der imperialen Größe, die insbesondere im 18. Jahrhundert an Bedeutung gewann, war der Glaube, einen seit der Regierungszeit von Kaiser Augustus (63 v. Chr.–14) nicht mehr erreichten Höhepunkt von Zivilisation und Kultur erreicht zu haben, ein wichtiger Aspekt.22 Imperialer Gestus und Übernahme einer antiken Terminologie wurden auch im Zarenreich des 18. Jahrhunderts üblich, etwa mit der Annahme des Imperatorentitels durch Zar Peter I. (1672–1725).23
Der humanistische Gegenentwurf zur Reichsidee in Italien
Der Humanismus brachte einen dezidiert anti-imperialen Reflex in das Modell Antike ein, und mit einer gewissen Folgerichtigkeit beschäftigten sich die Humanisten vorzugsweise mit der römischen Republik und entwickelten ein großes Interesse an der römischen Historiographie. Aus der Beschäftigung mit der römischen Geschichte heraus wurde die Vorstellung entwickelt, Rom sei die perfekteste Kultur gewesen, die jemals existiert habe, und ihre Langlebigkeit sei vor allem auf die außerordentliche Tugendhaftigkeit ihrer großen Männer gegründet gewesen.24 Dieses Modell sollte – gerade mit Blick auf den frühneuzeitlichen Republikanismus – eine extreme Beharrungskraft aufweisen.
Grundlegende republikanische Perspektiven auf die Antike, die zur entscheidenden Folie für spätere Verargumentierungen werden sollten, wurden insbesondere im Florenz der Renaissance entwickelt. Hier wie überall in Italien waren die schriftlichen und materiellen Überreste der Antike als unmittelbares Erbe präsent, und hier entwickelte sich die erste Blüte des Humanismus – stimuliert auch durch die Einwanderung gelehrter griechischer Flüchtlinge nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen.25 Insbesondere vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen mit Mailand im 14. und 15. Jahrhundert suchte die Florentiner Bürgerschaft, wie etwa die Schriften Leonardo Brunis (1369–1444) belegen, ihre Anciennität und ihre Unabhängigkeit mittels ihrer etruskischen und römischen Vergangenheit zu legitimieren.26
Der "Bürgerhumanismus", der sich in Florenz im Zuge der Auseinandersetzungen – wenn auch zweifellos auf der Basis mittelalterlich-genossenschaftlicher Wurzeln – entwickelte, orientierte sich am Modell der römischen Republik.27 Wie ihre Vorgänger nutzten auch Francesco Guicciardini (1483–1540) und Niccolò Machiavelli (1469–1527)[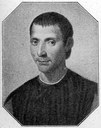 ] das römische Vorbild als Folie zur Beschreibung ihrer vom französisch-habsburgischen Ringen um Italien und vom Machtkampf zwischen Signoria und dem Hause Medici geprägten krisenhaften Gegenwart des 16. Jahrhunderts.28 Insbesondere für Machiavelli stellte das republikanische Rom – ganz im Sinne der von Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.) geprägten Vorstellung Historia magistra vitae ("Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens") – eine Referenzgröße zur Gewinnung praktischer politischer Handlungsmaximen dar. Es war somit ein Vorbild, dem es nachzueifern galt, um die Krise des Florentinischen Staatswesens zu überwinden.29 Machiavellis Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio ("Abhandlungen über die ersten zehn Bücher des Titus Livius") sind daher weit mehr als nur ein Livius-Kommentar, sondern überdies eine Analyse der römischen Republik mit dem Ziel der Nachahmung.30
] das römische Vorbild als Folie zur Beschreibung ihrer vom französisch-habsburgischen Ringen um Italien und vom Machtkampf zwischen Signoria und dem Hause Medici geprägten krisenhaften Gegenwart des 16. Jahrhunderts.28 Insbesondere für Machiavelli stellte das republikanische Rom – ganz im Sinne der von Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.) geprägten Vorstellung Historia magistra vitae ("Geschichte ist die Lehrmeisterin des Lebens") – eine Referenzgröße zur Gewinnung praktischer politischer Handlungsmaximen dar. Es war somit ein Vorbild, dem es nachzueifern galt, um die Krise des Florentinischen Staatswesens zu überwinden.29 Machiavellis Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio ("Abhandlungen über die ersten zehn Bücher des Titus Livius") sind daher weit mehr als nur ein Livius-Kommentar, sondern überdies eine Analyse der römischen Republik mit dem Ziel der Nachahmung.30
Sparta und das republikanische Rom erscheinen bei Machiavelli vor allem als Beispiele einer gelungenen Mischverfassung im Sinne des erst von Leonardo Bruni wiederentdeckten griechischen Geschichtsschreibers Polybios (200–120 v. Chr.). Die Stabilität beider Staatswesen beruhte demnach auf der klugen Kombination der Verfassungsformen Monarchie, Aristokratie und Demokratie, die zugleich Repräsentationen unterschiedlicher sozialer Schichten beinhalteten,31 sowie auf einem überlegenen Heerwesen.32 Machiavelli bediente sich also einer spezifischen, griechischen Interpretation des Aufstiegs Roms, die im zweiten vorchristlichen Jahrhundert entstanden war, um die griechische Unterlegenheit zu erklären, und die bereits in der Antike selbst vielfältige Rezeptions- und Aneignungsprozesse durchlaufen hatte.33
Bei Machiavelli wie auch bei zahlreichen weiteren Autoren im Italien seiner Zeit konnten Rom und Sparta somit als Modelle einer Ordnung dienen, die sowohl als zu verwirklichendes Ideal als auch als historische Wirklichkeit wahrgenommen wurde und Stabilität nach innen wie auch Expansion und Herrschaft nach außen verkörperte.34 Insbesondere die Discorsi Machiavellis boten in der Folgezeit eine Folie für republikanische Lesarten von Titus Livius (59–17 n. Chr.) oder Polybios und ermöglichten auch nördlich der Alpen Konstruktionen des Modells Antike, wie die folgenden Ausführungen zeigen werden.35
Reformation, Konfessionskriege und die Suche nach staatlicher Ordnung
Akut wurden auf Antike bezogene und zumindest potentiell gegen die herrschenden Monarchen gerichtete Argumentationsstrategien, als in der Folge der Reformation konfessionelle Brüche zwischen Herrschaft und Teilen der Untertanen entstanden. Sowohl die calvinistischen Monarchomachen ("Königsbekämpfer") in Frankreich als auch der niederländische Aufstand brachten zahlreiche Schriften zum Widerstandsrecht hervor und entwickelten eine Freiheitssymbolik, die beträchtlichen Einfluss auch auf die folgenden Jahrhunderte hatte. So gestanden etwa Johannes Calvin (1509–1564) und Philipp Melanchthon (1497–1560) nur bestimmten, mit den spartanischen Ephoren, den attischen Demarchen und den römischen Volkstribunen verglichenen Amtsträgern ein aktives Widerstandsrecht zu.36 Das nach der Bartholomäusnacht in Basel publizierte Traktat Vindiciae contra tyrannos (1579) hingegen lobte im Extremfall auch einen privaten Tyrannenmörder, wenn er wie Marcus Iunius Brutus (85–42 v. Chr.), Marcus Porcius Cato (95–46 v. Chr.) oder Cicero die Freiheit verteidigte.37 Die Diskussion um das Widerstandsrecht wurde daher eng mit diesen Figuren verknüpft, und schon das Pseudonym des bis heute ungeklärten Autors der Vindiciae,38 Stephanus Iunius Brutus, verweist auf das Vorbild der römischen Republik.39
Insbesondere der jüngere Brutus und die Ermordung von Gaius Iulius Caesar (100–44 v. Chr.) wurden auch andernorts zu Sinnbildern und Modellen für Widerstand und Freiheit, so etwa auf einer Münze des Lorenzino de' Medici (1514–1548), dessen Ermordung Alessandro de' Medicis (1510–1537) in Imitation der bekannten Brutus-Münze als Tyrannenmord dargestellt wurde.40 Auch im Reich konnte der Kampf der Stände gegen Karl V. (1500–1558) um die "Teutsche Libertät" mithilfe solcher Legitimationsmuster geführt werden. So zeigt die von Frankreich aus ins Reich distribuierte Flugschrift Sendschrifften der Königlichen Maiestat zu Franckreich
als Tyrannenmord dargestellt wurde.40 Auch im Reich konnte der Kampf der Stände gegen Karl V. (1500–1558) um die "Teutsche Libertät" mithilfe solcher Legitimationsmuster geführt werden. So zeigt die von Frankreich aus ins Reich distribuierte Flugschrift Sendschrifften der Königlichen Maiestat zu Franckreich ebenfalls die Dolche des Tyrannenmörders und den Pileus, die Mütze der römischen Freigelassenen, mit der Bildunterschrift "Libertas".41 In unmissverständlicher Deutlichkeit wird hier der legitime Widerstand des Reichsverbands gegen eine befürchtete habsburgische Tyrannei in einen Argumentationszusammenhang mit der Verteidigung der römischen Republik durch die Ermordung Caesars gerückt.
ebenfalls die Dolche des Tyrannenmörders und den Pileus, die Mütze der römischen Freigelassenen, mit der Bildunterschrift "Libertas".41 In unmissverständlicher Deutlichkeit wird hier der legitime Widerstand des Reichsverbands gegen eine befürchtete habsburgische Tyrannei in einen Argumentationszusammenhang mit der Verteidigung der römischen Republik durch die Ermordung Caesars gerückt.
Der Humanismus, aber auch das konfessionelle Ringen beförderte zudem erheblich die Entstehung nationaler Identitäten. In den seit 1568 um ihre Unabhängigkeit von Spanien kämpfenden Niederlanden spielten Vorstellungen von den antiken Batavern eine erhebliche Rolle für die nationale Identitätsfindung, so wie der Germanenbezug nach der Entdeckung der Germania des Cornelius Tacitus (ca. 55–120) in der Abtei Hersfeld um 1450 für die deutschen Humanisten zum Bezugspunkt nationaler Identität werden konnte.42
eine erhebliche Rolle für die nationale Identitätsfindung, so wie der Germanenbezug nach der Entdeckung der Germania des Cornelius Tacitus (ca. 55–120) in der Abtei Hersfeld um 1450 für die deutschen Humanisten zum Bezugspunkt nationaler Identität werden konnte.42
Auf der anderen Seite bedienten sich auch die Monarchien antiker Bezüge. Schon seit dem Mittelalter verweist der Begriff "Monarchie" auf die Staatsformenlehre von Aristoteles (384–322 v. Chr.).43 Das Konzept bezog sich noch bis ins 17. Jahrhundert immer auch auf die römische Weltmonarchie und hatte somit einen universalistischen Zug.44 Obwohl also Rom gewissermaßen das Modell der Monarchie schlechthin war, rückten jedoch manche von einem solchen universalen, auf das eschatologisch verstandene römische Kaisertum bezogenen Monarchiebegriff ab. Für Jean Bodin (1529–1596) etwa war das Heilige Römische Reich Deutscher Nation noch nicht einmal eine Monarchie, sondern ein aristokratisches Gebilde.45 In enger Anlehnung an die aristotelische Theorie blieb die Monarchie an die Herrschaft eines einzelnen gebunden, doch neben der Legitimierung aus der antiken Staatsformenlehre war vor allem die biblisch-patriarchalische Begründung von zentraler Bedeutung. So wichtig auch die von Cicero und anderen antiken Autoren übernommene Bezeichnung des Herrschers als "pater patriae" ("Vater des Vaterlandes") war, sie war doch stark aufgeladen mit Vorstellungen vom Landesherrn als Hausvater und Ideen einer kosmischen Ordnung, an deren Spitze Gott ebenfalls als Alleinherrscher stand.46
Überdies versuchten alle europäischen Dynastien, sich über Bezüge zur antiken Mythologie und Geschichte zu legitimieren. Dazu gehörten auch die Versuche unterschiedlicher Herrscherhäuser, ihre eigene Herkunft aus der Antike herzuleiten. Neben einer direkten Abstammung von Noah oder trojanischen Vorfahren wurde in der dynastienahen Historiographie des Hauses Habsburg auch eine Herkunft aus dem römischen Geschlecht der Julier ins Feld geführt.47 Obwohl Antike hier eher dem Nachweis von Alter und Vorrang und der Produktion von Dignität diente, scheint sie zugleich ein normativer Bezugsrahmen herrschaftlicher Selbstdarstellung und Inszenierung gewesen zu sein. Auf die Triumphpforte von Innsbruck wurde bereits hingewiesen, zahlreiche weitere Beispiele ließen sich finden. So ähnelt die von François Blondel (1618–1686) 1672 zu Ehren Ludwigs XIV. von Frankreich fertiggestellte Porte Saint-Denis dem Titus-Bogen und zeigt den Sonnenkönig in ihren Reliefs in römischer Feldherrenrüstung.
dem Titus-Bogen und zeigt den Sonnenkönig in ihren Reliefs in römischer Feldherrenrüstung.
Generell spielen antike Entlehnungen gerade im Hinblick auf die heroisch-militärischen Aspekte von Herrscherbildern eine beträchtliche Rolle. Insbesondere im Barock wurden Reiterstandbilder und bildhafte Darstellungen von Herrschern in römischer Rüstung allgemein üblich. Beispielhaft sei hier auf Andreas Schlüters (ca. 1660–1714) Denkmal des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg (1620–1688) oder Peter Scheemakers' (1691–1781) vergoldete Reiterstatue Wilhelms III. von England (1650–1702) hingewiesen. In diesen Zusammenhang gehören auch die Gleichsetzungen frühneuzeitlicher Herrscher mit den großen Feldherren und Herrschern der Antike, ganz besonders Alexander dem Großen (356–323 v. Chr.) und Caesar.48 Hinzu kamen Übernahmen aus der antiken Mythologie. Herkules und Mars waren häufige Musterbilder, die in Text und Bild auf die Herrschertugenden der Tapferkeit und Stärke verwiesen.49 Bei Ludwig XIV. von Frankreich kam noch Apoll hinzu, der in der Inszenierung des "Sonnenkönigs" eine zentrale Rolle spielte.50 Im Falle weiblicher Herrschaft konnten andere Bezüge hinzutreten, wie etwa der Rekurs auf die heilsbringende Astraea bei Elisabeth I. von England (1533–1603) zeigt.51
Wilhelms III. von England (1650–1702) hingewiesen. In diesen Zusammenhang gehören auch die Gleichsetzungen frühneuzeitlicher Herrscher mit den großen Feldherren und Herrschern der Antike, ganz besonders Alexander dem Großen (356–323 v. Chr.) und Caesar.48 Hinzu kamen Übernahmen aus der antiken Mythologie. Herkules und Mars waren häufige Musterbilder, die in Text und Bild auf die Herrschertugenden der Tapferkeit und Stärke verwiesen.49 Bei Ludwig XIV. von Frankreich kam noch Apoll hinzu, der in der Inszenierung des "Sonnenkönigs" eine zentrale Rolle spielte.50 Im Falle weiblicher Herrschaft konnten andere Bezüge hinzutreten, wie etwa der Rekurs auf die heilsbringende Astraea bei Elisabeth I. von England (1533–1603) zeigt.51
Festzustellen ist, dass die antiken Herrscher-, Heroen- und Götterfiguren zu Idealtypen gerannen, die ganz bestimmte Eigenschaften und Tugenden bezeichnen und bisweilen programmatischen Charakter haben konnten. Es liegt auf der Hand, dass ihre inhaltliche Ausfüllung nur noch wenig mit der Breite der historischen Überlieferung zu tun hatte, dass aber gerade darin ihre Wirksamkeit als Modell begründet lag. Es handelte sich um Schablonen, mit deren Hilfe Herrscherbilder für eine politisch interessierte Öffentlichkeit vorgeprägt werden konnten.
Der wesentlich von Justus Lipsius (1547–1606) geprägte späthumanistische Neostoizismus knüpfte ebenfalls direkt an antike Vorbilder an, namentlich die römische, von Lucius Annaeus Seneca (4 v. Chr.–65) und Marc Aurel (121–180) vertretene, ursprünglich griechische Stoa. Zusammen mit der verstärkten Tacitus-Rezeption, die auch im Lichte der nach den konfessionellen Unruhen wieder erstarkenden Staaten zu sehen ist,52 bot der Neostoizismus frühneuzeitlichen Herrschern neue Modelle der "Sozialdisziplinierung" und Herrschertugend und konnte im aufstrebenden Brandenburg-Preußen gar zu einer Art Leitideologie aufsteigen.53 Betont wurden in der Forschung auch die Verbindungen zur "Oranischen Heeresreform", die sich selbst wiederum als Weiterführung antiker militärstrategischer Modelle verstand.54
Revolution und Opposition in England
In England wurden im Zuge des Bürgerkriegs ab 1642 auch republikanische Theorien ausformuliert, die sich insbesondere in den 1650er Jahren, während des Commonwealth, explizit antiker Modelle bedienten. Hier bot die Mischverfassungstheorie Anknüpfungspunkte, die eine insbesondere durch Machiavelli vermittelte Aneignung antiker Modelle begünstigte. Das Zusammenwirken der Krone und der in beiden Häusern des Parlaments versammelten Stände war von Juristen wie John Fortescue (ca. 1394–1476) noch ganz im Sinne des Common Law als "dominium politicum et regale" ("konstitutive Monarchie") dargestellt worden,55 wurde jedoch im Kontext des sich zum Bürgerkrieg zuspitzenden Konflikts als eine an Polybios angelehnte Mischverfassung beschrieben.56 In einer spezifischen Aneignungssituation, in der beide Konfliktparteien noch um Ausgleich bemüht waren und sich zugleich als Hüter der Verfassung empfehlen wollten, griffen sie auf ein Modell zurück, das geeignet schien, Akzeptanz zu finden und die Frage nach der Souveränität in einem Kompromiss aufzulösen.57
Mit der Hinrichtung Karls I. (1600–1649) am 30. Januar 1649 und der kurz darauf erfolgten Abschaffung der Monarchie verschob sich die Argumentation der Republikaner noch deutlicher zum Modell Antike. Insbesondere James Harrington (1611–1677) hob 1656 die "ancient prudence", die politische Weisheit der Antike, positiv von der späteren Zeit ab. Die Grundlagen antiker Verfassungen lagen für Harrington vor allem in der klugen Mischung der Staatsformen und dem daraus resultierenden System der checks and balances. Gemäß seinem polybianischen Vorbild sah Harrington – neben dem biblischen Israel und der Republik Venedig – vor allem in Rom und Sparta die nachahmenswerten Modelle einer Republik.58 Zugleich konnte im Zuge dieser am Modell Antike orientierten Umdeutung der englischen Verfassung auch das alte System der Grafschafts-Milizen – erneut in Anlehnung an Machiavellis Deutungen von Sparta und Rom – als tugendfördernde Einheit von Bürger und Soldat neu bewertet werden. Diese Umdeutung sollte schließlich auch in Nordamerika wirkmächtig werden.59
Antike, das wird sowohl bei Harrington als auch bei Marchamont Nedham (1620–1678) deutlich, diente als Orientierungsrahmen in einer politisch präzedenzlosen Situation, zumal sie, und hier ganz besonders Rom, mit der Aura des Erfolgs und der Größe verknüpft war, der es nachzueifern galt. Für Griechenland traf das nur bedingt zu; während Sparta als Modell noch präsent war, galt das vermeintlich unruhige und anarchische Athen den meisten Autoren daher dezidiert nicht als Modell.60 Die durch die Rom-Rezeption evozierten Bilder gingen weit über eine rhetorische Ornamentik hinaus und wurden als in der historischen Wirklichkeit liegende Idealbilder mit einer normativen Leitfunktion versehen. Zugleich wurden die Bilder und Modelle von der Gegenwart her aufgeladen und interpretiert, wobei gerade in der englischen Verargumentierung von Antike Machiavellis Thesen die Linsen bildeten, durch die die Antike gelesen wurde.61 Gleiches gilt auch für die Rekurse auf antike Republiken in der radikalen Whig-Literatur der Restaurations-Ära, etwa im Plato redivivus von Henry Neville (1620–1694) oder dem Essay upon the Constitution of the Roman Government von Walter Moyle (1672–1721).62
Während das Modell Antike für die Legitimation und Begründung der Glorious Revolution von 1688/1689 ganz hinter christliche und teleologische Deutungsmuster zurücktrat,63 wurde es in seiner republikanischen Ausformung beginnend schon mit der Wiederveröffentlichung der Werke Harringtons im Jahre 1700 und verstärkt dann nach 1714 wiederbelebt. Das große Thema der 1720er Jahre war die "corruption" der neuen Geldelite Londons und der herrschenden Whig-Oligarchie um Robert Walpole (1676–1745), der – etwa in John Trenchards (1662–1723) und Thomas Gordons (gest. 1750) mit dem Namen Cato unterzeichneten Artikelserie64 – die "virtue" der Antike entgegengestellt wurde.65 Die römische Republik konnte vor dem befürchteten Verfall englischer Freiheit als warnendes Beispiel dienen, wenn man sich wie Joseph Addisons (1672–1719) Tragödie Cato (1713)66 auf ihr Ende konzentrierte; sie konnte aber auch als Musterbild einer guten Verfassung hingestellt werden, an der England sich orientieren konnte. Henry St. John Viscount Bolingbroke (1678–1751) schlug in seiner Dissertation Upon Parties (1733–1734) vor, die römische Verfassung auf ihre Grundideen zurückzuführen und mit der englischen zu vergleichen, um die Ursachen ihres Aufstiegs und Verfalls zu analysieren und der zeitgenössischen Korruption vorzubeugen.67 Freilich ist Bolingbrokes Darstellung der römischen Verfassung ebenso wie diejenige Harringtons nicht frei von Kritik,68 und das römische Modell kann nicht mehr wie noch zu Zeiten Machiavellis als bedingungsloses Muster für neuzeitliches Handeln angesehen werden.
Die Revolutionen des ausgehenden 18. Jahrhunderts
Auch im Kontext der Amerikanischen Revolution weisen publizierte Äußerungen auf eine eher kritische Rezeption antiker Modelle hin.69 Und dennoch wurde gerade hier, ebenso wie wenig später in Frankreich, die Antike zum alles überragenden Vorbild. Konnte einerseits das britische Mutterland als das dekadente und korrupte Imperium Romanum präsentiert werden (siehe unten), so diente das republikanische Rom andererseits als unerschöpflicher Fundus republikanischer Modelle, Riten und Symbole. Die durch die Folien der englischen und teilweise auch französischen Rezeption gelesenen antiken Autoren Polybius, Livius, Plutarch (45–120) und Cicero prägten das Bild der römischen Republik ebenso wie Charles Rollins (1661–1741) weit verbreitete, zudem eng an Livius angelehnte Histoire Romaine (1738–1748, englisch Roman History, 1739–1750).70 Das Bild der römischen Republik beruhte weitgehend auf den Mustern, die bereits in England etabliert waren, einer Republik mit einer ausbalancierten Mischverfassung und der Fähigkeit zur Expansion, in der durchaus bereits ein imperialer Gedanke angelegt war (siehe unten). Sie konnte aber – und das war entscheidend – von der jungen amerikanischen Republik übertroffen werden.71 Doch selbst in der kritischen Auseinandersetzung mit antiken Verfassungsmodellen zeigt sich der hohe Wert, der antiken Beispielen als Orientierungsrahmen beigemessen wurde.
Ähnliche Beobachtungen lassen sich auch für das revolutionäre Frankreich machen. Bereits im Aufklärungsdiskurs des 18. Jahrhunderts hatten sich bestimmte Wahrnehmungs- und Rezeptionsmuster herausgebildet, die insbesondere Sparta und Rom als Idealrepubliken erscheinen ließen und die gerade in ihrer Schlichtheit Raum für patriotische Gesinnung und aktive Tugend boten.72 Die Überwindung der Despotie durch die Revolution konnte daher einerseits als Neubeginn, andererseits aber auch als Rückbesinnung auf die idealisierten Werte der antiken Republiken wahrgenommen werden.73 Auch wenn ein direkter Einfluss dessen, was man für antike republikanische Verfassungen hielt, wohl eher gering war, so spielte das Modell Antike in seinen vielfachen Brechungen für die Selbstdeutung der Revolutionäre eine beträchtliche Rolle. Wenn Camille Desmoulins (1760–1794) sich der Negativbeispiele Tiberius (42 v. Chr.–37), Claudius (10 v. Chr.–54), Nero (37–68), Caligula (12–41) oder Domitian (51–96) bediente, um die Errungenschaften der Republik zu betonen,74 oder Gracchus Babeuf (1760–1797) in seinem Manifeste des Plébéiens eine "Vendée plébéienne" forderte und dabei das Vorbild des Auszugs der Plebejer aus Rom beschwor,75 so sind das deutliche Hinweise auf die Modellhaftigkeit insbesondere der römischen Antike.76 Die Benennung von Ämtern in der französischen Republik, etwa die Einführung des Konsulats nach dem 18. Brumaire VIII (9. November 1799),77 deuten ebenfalls auf Rom als Referenzrahmen kollektiver Sinnzuschreibungen hin.
Für den Republikanismus spielte die Tugend des Bürgers eine zentrale Rolle, und zahlreiche antike Autoren wie Livius, Tacitus oder Plutarch boten hierzu Anschauungsmaterial. Schon Machiavelli betonte die Notwendigkeit der Bürgertugend zur Erhaltung oder Wiedergewinnung der Freiheit,78 und auch für andere wie etwa Bolingbroke war es weniger die Verfassung Roms als die Tugend und Freiheitsliebe seiner Bürger, die das republikanische System so lange aufrechterhalten hätten.79 Bemühungen, den Bürger zum vorbildlichen Republikaner zu formen, brachten mit sich, dass einzelne antike Figuren wie Lucius Junius Brutus (ca. 5. Jahrhundert v. Chr.), Cato oder Cincinnatus (ca. 5. Jahrhundert v. Chr.) zu Vorbildern stilisiert wurden. So diente im 18. Jahrhundert insbesondere Brutus als Muster republikanischer Tugend, vor allem im Kontext der Französischen Revolution. Einen kaum zu überschätzenden Einfluss dürfte dabei Voltaires (1694–1778) Tragödie über den älteren Brutus gehabt haben, auch wenn der Erfolg des Stücks, das 1731 in Paris uraufgeführt wurde, tatsächlich bis zur Revolution auf sich warten ließ.80 Brutus, der seine eigenen Söhne für den Erhalt der Republik zu opfern bereit war, wurde gewissermaßen zum Idealbild des republikanischen Bürgers erklärt, so etwa in Jacques-Louis Davids (1748–1825) großformatigem Gemälde Les Licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils (1789).81
Les Licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils (1789).81
Gleiches gilt für die Figur Cato. Sein Freitod in Utica wurde etwa von Addison als Tod für die Freiheit, als unbedingte Hingabe an die Republik gedeutet.82 Cato erlebte in der Folgezeit in England und Nordamerika eine besondere Konjunktur. Cato's Letters von Trenchard und Gordon wurden zu einem Medium der politischen Opposition, und Addisons Cato zum Lieblingsstück George Washingtons (1732–1799), der dieses sogar im Winterlager in Valley Forge vor seinen Truppen aufführen ließ.83 Auch die Geschichte des Cincinnatus, der als Kleinbauer vom Pflug weg in das Amt des Diktators berufen wurde und nach getaner Arbeit zu seinem Pflug zurückkehrte, erlebte in den USA eine enorme Popularität, insbesondere durch die Gleichsetzung mit George Washington, die sich übrigens auch in der Gründung der Society of the Cincinnati und die Namensgebung der Hauptstadt des Bundesstaates Ohio niederschlug.84 Die Betonung von Bürgertugend, Bescheidenheit und Immunität gegen Korruption waren die entscheidenden Merkmale dieser Figuren, deren Rezeptionsgeschichte schon in der Antike selbst vielschichtig war.85
Gerade an Modellen wie Cato und Brutus wird jedoch auch der tugendbezogene und stoische Zug des frühneuzeitlichen Republikanismus deutlich, der ihn klar vom zeitgenössischen Liberalismus abhebt. Römer und Spartaner wurden vor allem als Idealisten gezeichnet, die bereit waren, für die "Freiheit" und ihre "patria" selbst ihre Söhne oder ihr eigenes Leben zu opfern. Freiheit verwirklichte sich in der aktiven Partizipation als zoon politikon, und nicht in der Abwesenheit von Zwängen und der individuellen Handlungsfreiheit.86 Dabei übernahmen frühneuzeitliche Autoren freilich bestimmte Tugenddiskurse der Antike in ihr Bild antiker Realität, die sie wiederum zum Modell des eigenen Strebens nach Tugend machten.87
Der Gebrauch der Toga bei Rednern der Amerikanischen wie auch der Französischen Revolution, die Verwendung antiker Amtsbezeichnungen wie Konsuln, Senatoren etc. oder der nahezu omnipräsente Gebrauch der fasces sowie der phrygischen Mützen
sowie der phrygischen Mützen verweist zweifellos auch auf eine Identifikation mit der (insbesondere römischen) Antike, die weit in Habitus und Praxis
verweist zweifellos auch auf eine Identifikation mit der (insbesondere römischen) Antike, die weit in Habitus und Praxis hineinreichte, wobei in Architektur, Kunst und materieller Alltagskultur sowohl in Amerika als auch in Europa durchaus auch griechische Formensprachen rezipiert wurden.88 Zu fragen wäre, inwieweit hier stärker bürgerliche Aneignungsbedürfnisse zum Ausdruck kamen. Noch immer, bis in die Französische Republik hinein, ist aber der frühneuzeitliche Reflex erkennbar, das Neue an der Normativität der Antike zu messen und in ihm eine Wiederbelebung des Alten zu erkennen. Gerade in Frankreich war die Idee des Neubeginns mit der Rückkehr zum Modell Antike verbunden, und der Wegfall christlicher Orientierungshorizonte für die Elite der Französischen Revolution verstärkte diese Tendenz noch einmal.89
hineinreichte, wobei in Architektur, Kunst und materieller Alltagskultur sowohl in Amerika als auch in Europa durchaus auch griechische Formensprachen rezipiert wurden.88 Zu fragen wäre, inwieweit hier stärker bürgerliche Aneignungsbedürfnisse zum Ausdruck kamen. Noch immer, bis in die Französische Republik hinein, ist aber der frühneuzeitliche Reflex erkennbar, das Neue an der Normativität der Antike zu messen und in ihm eine Wiederbelebung des Alten zu erkennen. Gerade in Frankreich war die Idee des Neubeginns mit der Rückkehr zum Modell Antike verbunden, und der Wegfall christlicher Orientierungshorizonte für die Elite der Französischen Revolution verstärkte diese Tendenz noch einmal.89
Neues Rom und neue Imperien?
Rom ist an allen Enden die bewußte oder stillschweigende Voraussetzung unseres Anschauens und Denkens; denn wenn wir jetzt in den wesentlichen geistigen Dingen nicht mehr dem einzelnen Volk und Land, sondern der okzidentalen Kultur angehören, so ist dies die Folge davon, daß einst die Welt römisch, universal war und daß diese antike Gesamtkultur in die unserige übergegangen ist. Daß Orient und Okzident zusammengehören, daß sie eine Menschheit bilden, verdankt die Welt Rom und seinem Imperium.90
Diese Äußerung Jacob Burckhardts (1818–1897) zeigt deutlich die Bedeutung auf, die Rom und seinem Imperium im westlichen Denken zukommen. Dahinter steht die Idee von Rom als universaler, Frieden und Zivilisation bringender Ordnungsmacht. Einerseits veranlasste gerade diese Idee die verschiedenen politischen Entitäten dazu, bewusst auf Rom und sein Imperium zu rekurrieren, um die politischen Ziele und Belange der eigenen Gegenwart historisch zu verargumentieren bzw. die eigene Herrschaft angesichts eines sich durch die jeweilige politische Formation selbst zugeschriebenen zivilisatorischen, ordnungsstiftenden Auftrags positiv im Gefolge des Imperium Romanum nach außen darzustellen bzw. Herrschaft über fremde Völker zu rechtfertigen. Andererseits schuf die Nutzung des Modells Rom bzw. Imperium Romanum auch Erwartungen, die an Staaten bzw. politische Formationen in öffentlichen Diskursen herangetragen wurden und werden. Schließlich stülpt die professionelle bzw. halb-professionelle, in den zeitgenössischen Diskursen verhaftete Historiographie einer historischen Tatsache wie dem Imperium Romanum bewusst oder unbewusst zeitgenössische Modelle über und lässt sie im Umkehrschluss zum positiv oder auch negativ konnotierten Modell für die Gegenwart werden.
Bekannte Formulierungen wie "Neues Rom", "Zweites Rom", "Drittes Rom" usw. weisen in die Richtung des eben Gesagten. Bezeichnenderweise wurde den USA schon früh der Status eines "Neuen Rom" zugesprochen, aus dem wiederum ein universaler, ordnungsstiftender Anspruch einer künftigen US-amerikanischen Weltherrschaft abgeleitet wurde. Im Jahr 1853 veröffentlichten der in die USA emigrierte Republikaner Theodor Poesche (1826–1899) und der Deutschamerikaner Charles Goepp (1827–1907) eine Schrift mit dem Titel The New Rome: Or The United States of the World, in der sie es als die Bestimmung der USA betrachteten, das Ideal einer Weltrepublik durchzusetzen, und die damaligen Vereinigten Staaten explizit mit dem jungen Rom verglichen, das im Begriff war, seine Flügel zu spreizen.91 Die USA sollten dementsprechend als Neues Rom die Aufgabe des Zusammenschlusses der Menschheit in Angriff nehmen und die überholten Grenzen des Nationalstaats überwinden.92
Eine solche Inanspruchnahme der USA für die Durchsetzung eines universalen Republikanismus mag nicht zuletzt durch die vielfältigen Bezüge zur Antike begründet sein, die in der Revolutions- und der ante bellum-Zeit in Nordamerika hergestellt wurden. Man denke in diesem Kontext nur an römische Namenswahlen wie "Senat" und "Kapitol" bzw. die Bedeutung klassizistischer Architektur, die einen Gipfel im State Capitol in Richmond (Virginia) findet, das die Maison Carrée in Nîmes
findet, das die Maison Carrée in Nîmes , einen römischen Tempel, imitiert.93 Bezeichnend ist auch die frühe Münzprägung der USA, so die Libertas Americana (1776)
, einen römischen Tempel, imitiert.93 Bezeichnend ist auch die frühe Münzprägung der USA, so die Libertas Americana (1776) .94
.94
Die neugegründeten USA machten damit Gebrauch von einer romanitas, in deren Tradition sie sich stellten. Rom lieferte ihnen eine Vergangenheit, die man nicht nur verargumentieren konnte, sondern die dem jungen Staat auch eine Legitimation gegenüber den europäischen Staaten lieferte. Dabei fungierte das Imperium Romanum in diesem Kontext eigentlich als ein Anti-Modell, wurden doch Vertreter Großbritanniens als dem Wahn verfallene römische Kaiser dargestellt, während man die britische Herrschaft mit der Tyrannei assoziierte, die man Rom gegenüber seinen Provinzen unterstellte. In inneramerikanischen Diskursen dienten das Imperium Romanum und sein Verfall zunehmend als Folie für Untergangsszenarien, die vor allem einer immer weiter um sich greifenden Missachtung des christlichen Glaubens und einer damit einhergehenden Dekadenz angelastet wurden.95 Umso bemerkenswerter ist die bis heute von außen bzw. in verschiedenen Diskursen immer wieder an die USA herangetragene Rolle eines neuen Rom und damit einhergehend die eines Imperiums. Im offiziellen Amerika wird die Existenz eines amerikanischen Imperiums weiterhin negiert, obwohl inneramerikanische Stimmen ein solches zunehmend positiv bewerten und vermehrt vorschlagen, die USA sollten zu einer liberalen imperialen Herrschaft übergehen, wobei wiederum das Imperium Romanum vor allem als Modell eines drohenden Niedergangs genannt wird.96
Im Ergebnis bleiben die USA damit eine Macht, die sich im inneren politischen Diskurs vom Modell des Imperium Romanum distanziert, der aber ein imperiales Handeln sowohl von Kritikern als auch von Befürwortern mit negativen und positiven Konnotationen attestiert wird. Die positive Konnotation verweist dabei auf den auf das Imperium Romanum rekurrierenden Traditionskern der weltweit ordnungs- und zivilisationsstiftenden Macht vor dem Hintergrund zeitgenössischer Folien. Freilich ist im politischen Diskurs der USA wie auch in ihrer Populärkultur das Modell des Imperium Romanum besonders in einer Hinsicht positiv verargumentiert worden, bildete das Römische Reich doch das Gefäß, in dem sich das Christentum über die Welt der (klassischen) Antike zu verbreiten und über die Imperatoren Roms zu triumphieren vermochte. Amerikanische Christenheit wurde im Zuge dessen mit dem Sieg über römisch-pagane Fremdheit assoziiert, wodurch der Krieg in Europa in den 1940er Jahren eine positive ideologische Aufladung erfuhr.97 Insgesamt wird damit am Beispiel der USA deutlich, dass der Traditionskern oder das Modell Imperium Romanum in deutlich differierende verargumentierende Folien eingebettet wird.
Die zeitgenössische Anwendung des Imperiumsbegriffs auf die USA steht freilich nicht allein da, sondern erfährt eine Weiterung insofern, als auch das zusammenwachsende Europa vor dem Hintergrund des Paradigmas Rom diskutiert wird. Dies ist insofern bemerkenswert, als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Rom und sein Imperium auch und gerade in der Fachwelt eher negativ beurteilt wurden.98 Gleichwohl lieferte der europäische Einigungsprozess die Folie für eine positive Nutzung des paradigmatischen Imperiums, indem sein Charakter als "Vielvölkerstaat" betont wurde.99 Mit einer gewissen Folgerichtigkeit wird in der Publizistik Rom als ein wohlwollendes Imperium betrachtet, auf dessen Spuren sich ein geeintes Europa als Weltmacht zu bewegen habe.100
Während die USA in der politischen Selbstwahrnehmung seit der Revolution einen anti-imperialen Diskurs pflegen, knüpfte etwa das British Empire an die schon vielfach genannte ordnungs-, zivilisations- und friedensstiftende Konnotation des Imperium Romanum an, um eigene imperiale Ambitionen zu legitimieren. Bezeichnend ist hierzu eine Aussage von Benjamin Disraeli (1804–1881) aus dem Jahr 1859:
"One of the greatest of the Romans, when asked what were his politics, replied, Imperium et libertas. That would not make a bad programme for a British Ministry. It is one from which Her Majesty's advisers do not shrink."
Das angebliche Zitat eines der größten Römer ist reine Fiktion,101 zeigt aber, dass das Römische Reich von einer imperialen Macht gleichsam als rechtfertigendes Modell für die eigenen Ambitionen genutzt wurde. War also das British Empire in Nordamerika und dann den USA als ein dem Imperium Romanum ähnliches Empire negativ beurteilt worden, wird aus dem Traditionskern in der britischen Selbstwahrnehmung ein positiv konnotiertes Modell. Nicht zufällig sind das 18., 19. und 20. Jahrhundert die Hochzeit historischer Analysen des Römischen Reichs gewesen. Dabei bildet die Forschung auch die jeweilige Ideologie zeitgenössischer imperialer Mächte ab und liefert diesen damit wiederum aus der Historie geschöpfte Leitbilder für ihr politisches Handeln.102
Diese innigliche Verschränkung zwischen jeweils aktuellem politischem Handeln, der hiervon geprägten historischen Forschung und den aus der Historie geschöpften Exempeln und Argumenten für politisches Handeln ist freilich nicht nur im Falle des British Empire zu beobachten. Sie gilt etwa auch und gerade für das liberale Italien. Obwohl die Rom-Idee im Risorgimento eigentlich durch ihre Universalität diskreditiert war, bildete die römische Geschichte bzw. das aus ihr geschöpfte Argument der romanità den Hebel für die Konstruktion des Nationalbewusstseins in dem seit 1860 werdenden Nationalstaat. Rom wurde damit zum Modell, das dem Nationalstaat des in vielerlei Hinsicht äußerst heterogenen Italien die Folie für eine gemeinsame Vergangenheit liefern konnte.103 Eine solche Konstruktion wurde sowohl von Literaten als auch von professionellen Historikern betrieben104 und lieferte die Basis für eine weitergehende Verargumentierung des Römischen Reiches insbesondere seit 1911 . In diesem Jahr beging man nicht nur den 50. Jahrestag der Gründung des italienischen Nationalstaats, sondern das liberale Italien begann auch nach dem Erwerb außeritalienischer Besitzungen zu trachten.105
. In diesem Jahr beging man nicht nur den 50. Jahrestag der Gründung des italienischen Nationalstaats, sondern das liberale Italien begann auch nach dem Erwerb außeritalienischer Besitzungen zu trachten.105
Die romanità war dabei nicht nur Argument für ein militärisches Eingreifen in Afrika, sondern man leitete aus ihr einen speziellen zivilisatorischen und kulturellen Auftrag Italiens ab, der sich von orientalischer Dekadenz und dem "gotischen" Materialismus (in Gestalt von Protestantismus und Sozialismus / Kommunismus) wohltuend abhob. Mit dieser Geisteshaltung schuf man nicht nur eine weitgehende Akzeptanz für die kolonialen Gelüste des liberalen Italien in Ober- und Mittelschicht, sondern bereitete auch den Weg für den nach "natürlichen" Grenzen Italiens strebenden Irredentismus und letztlich auch die Wiederversöhnung von Staat und Kirche, die freilich erst Benito Mussolini (1883–1945) in Szene setzen sollte.106 Wie sehr Rom und sein Reich ein Modell für die Irredentisten bildete, zeigt die "Besetzung" von Fiume (Rijeka) im September 1919 durch Soldaten unter der Führung Gabriele D'Annunzios (1863–1938). In einer Ansprache an die italienischen, als "legionari" ("Legionäre") betitelten Soldaten in Fiume nahm D'Annunzio explizit Bezug auf Rom: "conviene che ciascuno di voi si pianti su i suoi due calcagni robusti e ripeta a fronte alta la parola romana, la parola dei legionari: 'qui rimarremo ottimamente'."107
Im faschistischen Italien findet sich dann nicht nur der Kult der romanità, sondern aus dieser wurde auch die italianità abgeleitet. Im Zuge dessen wurde Mussolini, der die Wiedererstehung des imperium Romanum proklamierte, mit Augustus gleichgesetzt.108 Auch die Ausgrabungen im Zentrum Roms und an anderen archäologischen Stätten wie etwa Pompeji standen im Dienst der Verargumentierung Roms in einem faschistischen Sinne.109 Noch nach 1945 vermochte die romanità eine gewichtige Rolle zu spielen. Als Nationalhymne der neuen Republik wählte man den aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammenden Canto degli Italiani ("Lied der Italiener") von Goffredo Mameli (1827–1849), in dessen Text Italien sich den Helm von Publius Cornelius Scipio (236–183 v. Chr.) aufsetzt, die Göttin Victoria eine Sklavin Roms ist und die Brüder Italiens sich zu Kohorten formieren, um für Italien den Tod zu erleiden.110 Das Beispiel Italien demonstriert anschaulich, wie das Modell des Imperium Romanum sowohl in einer Republik als auch in einem dem Anspruch nach totalitären Staat auf verschiedenen Ebenen genutzt werden konnte und dazu von der einschlägigen Fachwissenschaft bereitgestellt wurde.
Insgesamt zeigt sich damit das Ausmaß der verschiedenen Verargumentierungsmöglichkeiten eines Modells wie dem des Imperium Romanum, das in der westlichen Welt gewiss das wirkmächtigste ist. Dabei bleiben im kulturellen Gedächtnis letztlich zum einen die zivilisatorische, friedens- und ordnungsstiftende Funktion, zum anderen die Erinnerung an die universale bzw. universalistische, nationale und kulturelle Unterschiede einebnende Staatsform erhalten. Beide Folien waren auf zeitgenössische politische Entitäten je nach politischem Standort anwendbar. Wie die Beispiele der USA und der EU zeigen, ist die Anwendung dieses historischen Modells unbeeindruckt von den dem Imperium Romanum eigenen historischen Realien und Strukturen auch heute noch gegeben. Das Modell Roms und seines Imperiums ist also heute lebendiger denn je.
Ulrich Niggemann / Kai Ruffing
Anhang
Quellen
Addison, Joseph: Cato: A Tragedy, and Selected Essays, hg. von Christine Dunn u.a., Indianapolis, IN 2004.
Babeuf, Gracchus: Textes Choisis, hg. von Claude Mazauric, Paris 1965.
Bodin, Jean: Les six livres de la république, Paris 1577. URL: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8626814r [2021-08-26]
Bolingbroke, Henry St. John: Political Writings, hg. von David Armitage, Cambridge 1997.
Brutus, Stephanus Junius: Vindiciae, Contra Tyrannos: sive, De Principis in Populum, Populique in Principem, legitima potestate, Stephano Iunio Bruto auctore, London 1689 [1. Aufl. Edinburgh 1579]. URL: http://archive.org/details/vindiciaecontrat00lang [2021-08-26]
Buchez, Philippe-Joseph-Benjamin / Roux-Lavergne, Pierre-Célestin: Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815: contenant la narration des événements [...] précédée d'une introduction sur l'histoire de France jusqu'à la convocation des États-Généraux, Paris 1834–1838, vol. 1–40.
Burckhardt, Jacob: Historische Fragmente, hg. von Emil Dürr, Stuttgart 1957.
Burckhardt, Jacob: Die Kultur der Renaissance in Italien: Ein Versuch, 11. Aufl., Stuttgart 1988.
Dennert, Jürgen (Hg.): Beza, Brutus, Hotman: Calvinistische Monarchomachen, Köln u.a. 1968.
Desmoulins, Camille: Le Vieux Cordelier, No. 3: Vivre libre ou mourir!, in: Philippe-Joseph-Benjamin Buchez / Pierre-Célestin Roux-Lavergne: Histoire parlementaire de la Révolution française, ou Journal des assemblées nationales depuis 1789 jusqu'en 1815: contenant la narration des événements [...] précédée d'une introduction sur l'histoire de France jusqu'à la convocation des États-Généraux, Paris 1837, vol. 31, S. 182–196.
Harrington, James: The Commonwealth of Oceana and A System of Politics, hg. von John G.A. Pocock, Cambridge 2003. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9781139137126 [2021-08-26]
Heinrich II. von Frankreich: Sendschrifften der Königlichen Maiestat zu Franckreich/ etc. An die Chur und Fürsten/ Stende und Stett des Heyligen Römischen Reichs Teutscher Nation/ darinn sie sich irer yetzigen Kriegsrüstung halben auffs kürtzest erklert: Henricus secundus Francorum rex, vindex libertatis Germaniae et principum captivorum, Marburg 1552. URL: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10143279-8 [2021-08-26]
Machiavelli, Niccolò: L'arte della guerra, in: Niccolò Machiavelli: Opere, hg. von Mario Bonfantini, Mailand u.a. 1963, S. 495–531.
Machiavelli, Niccolò: Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in: Niccolò Machiavelli: Opere, hg. von Mario Bonfantini, Mailand u.a. 1963, S. 87–420.
Nedham, Marchamont: The Excellencie of a Free-State: or, The Right Constitution of a Commonwealth: Wherein all Objections are Answered, and the Best Way to Secure the Peoples Liberties, Discovered: With Some Errors of Government, and Rules of Policie, London 1767 [1. Aufl. 1656]. URL: http://archive.org/details/excellencieoffre00nedh [2021-08-26]
Poesche, Theodore / Goepp, Charles: The New Rome: Or The United States of the World, New York 1853. URL: http://archive.org/details/newrome00poes [2021-08-26]
Robbins, Caroline (Hg.): Two English Republican Tracts, Cambridge 1969.
Rollin, Charles / Jean Baptiste Louis Crevier: The Roman History from the Foundation of Rome to the Battle of Actium, That is, to the End of the Commonwealth, London 1739–1750, vol. 1–16, vol. 1 (1768). URL: http://archive.org/details/romanhistoryfrom01roll [2021-08-26]
Trenchard, John / Gordon, Thomas: Cato's Letters: Or, Essays on Liberty, Civil and Religious, and Other Important Subjects, hg. von Ronald Hamowy, Indianapolis, IN 1995, vol. 1–2.
Voltaire: Brutus, tragédie, hg. von John Renwick, in: Ulla Kölving (Hg.): Les Œuvres complètes de Voltaire / The complete Works of Voltaire, Oxford 1998, vol. 5, S. 1–308.
Literatur
Alföldy, Geza: Das Imperium Romanum – ein Vorbild für das vereinte Europa, Basel 1999 (Jacob-Burckhardt-Gespräche auf Castelen 9).
Ayres, Philip: Classical Culture and the Idea of Rome in Eighteenth-Century England, Cambridge 1997.
Bailyn, Bernard: The Ideological Origins of the American Revolution, 14. Aufl., Cambridge, MA 1977.
Bandelli, Gino: Il mito di Roma al confine orientale d'Italia: Antichistica e politica nelle "Nuove Province" (1918–1938), in: Beat Näf (Hg.): Antike und Altertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus: Kolloquium Universität Zürich 14.–17. Oktober 1998, Mandelbachtal u.a. 2001, S. 125–144 (Texts and Studies in the History of Humanities 1).
Bang, Peter F. u.a. (Hg.): Tributary Empires in Global History, Basingstoke 2011. URL: https://doi.org/10.1057/9780230307674 [2021-08-26]
Baron, Hans: The Crisis of the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in an Age of Classicism and Tyranny, Princeton, NJ 1967. URL: http://hdl.handle.net/2027/heb.01379.0001.001 [2021-08-26]
Bassin, Mark: Geographies of Imperial Identity, in: Dominic Lieven (Hg.): The Cambridge History of Russia, vol. 2: Imperial Russia, 1689–1917, Cambridge 2006, S. 45–63. URL: https://doi.org/10.1017/CHOL9780521815291.005 [2021-08-26]
Bermbach, Udo: Widerstandsrecht, Souveränität, Kirche und Staat: Frankreich und Spanien im 16. Jahrhundert, in: Iring Fetscher u.a. (Hg.): Pipers Handbuch der politischen Ideen, vol. 3: Neuzeit: Von den Konfessionskriegen bis zur Aufklärung, München 1985, S. 101–162.
Bernstein, Frank: Der Anfang: Das vermeintliche Kaisertum des Augustus, in: Hartmut Leppin u.a. (Hg.): Kaisertum im ersten Jahrtausend: Wissenschaftlicher Begleitband zur Landesausstellung "Otto der Große und das Römische Reich: Kaisertum von Antike zum Mittelalter", Regensburg 2011, S. 17–54.
Bertelli, Sergio: Piazza Venezia: La creazione di uno spazio rituale per un nuovo Stato-nazione, in: Sergio Bertelli (Hg.): La chioma della vittoria: Scritti sull'identità degli italiani dall'Unità alla seconda Repubblica, Florenz 1997, S. 170–205.
Bondanella, Peter E.: The Eternal City: Roman Images in the Modern World, Chapel Hill, NC u.a. 1987.
Bosworth, Richard: Italy and the Approach of the First World War, London u.a. 1983. URL: https://doi.org/10.1007/978-1-349-17022-7 [2021-08-26]
Bosworth, Richard: Italy and the Wider World 1860–1960, London u.a. 1996. URL: https://doi.org/10.4324/9780203436264 [2021-08-26]
Brauneder, Wilhelm: Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, in: Friedrich Jaeger (Hg.): Enzyklopädie der Frühen Neuzeit, Stuttgart u.a. 2007, vol. 5, Sp. 317–322. URL. http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_279129 [2021-08-26]
Brice, Catherine: Le Vittoriano: Monumentalité publique et politique à Rome, Rom 1998 (Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome 301).
Brockmann, Thomas: Das Bild des Hauses Habsburg in der dynastischen Historiographie um 1700, in: Christoph Kampmann u.a. (Hg.): Bourbon – Habsburg – Oranien: Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700, Köln u.a. 2008, S. 27–57.
Bronfen, Elisabeth u.a. (Hg.): Hybride Kulturen: Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismusdebatte, Tübingen 1997 (Stauffenburg Discussion 4).
Bücher, Frank: Verargumentierte Geschichte: Exempla Romana im politischen Diskurs der späten römischen Republik, Stuttgart 2006 (HERMES Einzelschriften 96). URL: https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515124508 [2021-08-26]
Burke, Peter: Ludwig XIV.: Die Inszenierung des Sonnenkönigs, Berlin 1993.
Burke, Peter: Die Renaissance, Frankfurt am Main 1996.
Burtt, Shelley: Virtue Transformed: Political Argument in England, 1688–1740, Cambridge 1992.
Cagnetta, Mariella: Antichisti e impero fascista, Bari 1979.
Chihaia, Matei: Querelle des anciens et des modernes, in: Friedrich Jaeger (Hg.): Enzyklopädie der Neuzeit, Stuttgart u.a. 2009, vol. 10, Sp. 588–591. URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_333114 [2021-08-26]
Christ, Karl: Geschichte der Römischen Kaiserzeit: Von Augustus bis zu Konstantin, 6. Aufl., München 2009.
Cipriani, Giovanni: Republican Ideology and Humanistic Tradition: The Florentine Example, in: Helmut G. Koenigsberger (Hg.): Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit, München 1988 (Schriften des Historischen Kollegs: Kolloquien 11). URL: https://doi.org/10.1524/9783486595529-004 [2021-08-26]
Clark, Thomas: "let Cato's virtues fire": Cato Uticensis und die amerikanische Revolution, in: Ulrich Niggemann u.a. (Hg.): Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung 1763–1809, München 2011, S. 203–217 (Historische Zeitschrift: Beihefte 55). URL: https://doi.org/10.1515/9783110650846-012 [2021-08-26]
Claydon, Tony: William III and the Godly Revolution, Cambridge 1996. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9780511560453 [2021-08-26]
Conticello, Baldassare: Scienze, cultura e cronaca a Pompei nella prima metà del nostro secolo, in: Riccardo Redi: Gli ultimi giorni di Pompei, Neapel 1994, S. 15–25.
Conze, Werner: Monarchie IV: Tradition und Modernität: Verstaatlichung (16.–18. Jahrhundert), in: Otto Brunner u.a. (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe: Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1978, vol. 4, S. 168–189.
Dreitzel, Horst: Monarchiebegriffe in der Fürstengesellschaft: Semantik und Theorie der Einherrschaft in Deutschland von der Reformation bis zum Vormärz, Köln u.a. 1991.
Dreyer, Boris: Polybios, in: Hubert Cancik u.a. (Hg.): Der Neue Pauly, Leiden 2012. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e1000940 [2021-08-26]
Dunsch, Boris: "Exemplo aliis esse debetis": Cincinnatus in der antiken Literatur, in: Ulrich Niggemann u.a. (Hg.): Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung 1763–1809, München 2011, S. 219–247 (Historische Zeitschrift: Beihefte 55). URL: https://doi.org/10.1515/9783110650846-013 [2021-08-26]
Elm, Veit / Lottes, Günther / Senarclens, Vanessa de: Einleitung, in: Veit Elm u.a. (Hg.): Die Antike der Moderne: Vom Umgang mit der Antike im Europa des 18. Jahrhunderts, Hannover 2009, S. 7–10 (Aufklärung und Moderne 18).
Erben, Dietrich: Zum Verständnis des Modellbegriffs in der Kunstgeschichte: Das Beispiel des Invalidendoms in Paris und des Petersdoms in Rom, in: Christoph Kampmann u.a. (Hg.): Bourbon – Habsburg – Oranien: Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700, Köln u.a. 2008, S. 284–299.
Euben, J. Peter: Corruption, in: Terence Ball u.a. (Hg.): Political Innovation and Conceptual Change, Cambridge 1989, S. 220–246.
Ferguson, Niall: Das verleugnete Imperium: Chancen und Risiken amerikanischer Macht, Berlin 2004.
Ferling, John E.: The First of Men: A Life of George Washington, Knoxville, TN 1988. URL: https://hdl.handle.net/2027/heb.01352 [2021-08-26]
Fink, Zera S.: The Classical Republicans: An Essay in the Recovery of a Pattern of Thought in Seventeenth-Century England, 2. Aufl., New York 1962.
Fried, Johannes: Imperium Romanum: Das römische Reich und der mittelalterliche Reichsgedanke, in: Millennium 3 (2006), S. 1–42.
Fuhrmann, Manfred / Schmidt, Peter L.: Livius, T. röm. Geschichtsschreiber, 59 v. Chr.–17, in: Hubert Cancik u.a. (Hg.): Der Neue Pauly, Leiden 2012. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e708140 [2021-08-26]
Furtwangler, Albert: Cato at Valley Forge, in: Modern Language Quarterly 41 (1980), S. 38–53.
Gabba, Emilio: Cesare e Augusto nell'opera storica di Guglielmo Ferrero, in: Karl Christ u.a. (Hg.): Römische Geschichte und Zeitgeschichte in der deutschen und italienischen Altertumswissenschaft während des 19. und 20. Jahrhunderts I. Caesar und Augustus, Como 1989, S. 277–298 (Biblioteca di Athenaeum 12).
Gabba, Emilio: Cesare e Augusto nella storiografia italiana dell'ottocento, in: Karl Christ u.a. (Hg.): Römische Geschichte und Zeitgeschichte in der deutschen und italienischen Altertumswissenschaft während des 19. und 20. Jahrhunderts, vol. 1: Caesar und Augustus, Como 1989, S. 49–70 (Biblioteca di Athenaeum 12).
Gabba, Emilio: La "Storia di Roma" di Ruggero Bonghi, in: Karl Christ u.a. (Hg.): L'Antichità nell'Ottocento in Italia e Germania: Die Antike im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland, Bologna u.a. 1988, S. 179–198 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento 2).
Garnett, George: Editor's Introduction, in: George Garnett (Hg.): Stephanus Iunius Brutus, the Celt: Vindiciae Contra Tyrannos: or, concerning the legitimate power of a prince over the people, and of the people over a prince, Cambridge 1994, S. xix–lxxvi.
Gatta, Bruno: Italia irredenta, Udine 2007 (Civiltà del Risorgimento 7).
Gavrilov, Aleksandr: Rußland (RWG), in: Hubert Cancik u.a. (Hg.): Der Neue Pauly, Leiden 2012. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e15208430 [2021-08-26]
Giardina, Andrea / Vauchez, André: Il mito di Roma: Da Carlo Magno a Mussolini, Rom u.a. 2008.
Goldie, Marc: The Revolution of 1689 and the Structure of Political Argument: An Essay and an Annotated Bibliography of Pamphlets in the Allegiance Controversy, in: Bulletin of Research in the Humanities 83 (1980), S. 473–564.
Gollwitzer, Heinz: Geschichte des weltpolitischen Denkens, vol. 1: Vom Zeitalter der Entdeckungen bis zum Beginn des Imperialismus, Göttingen 1972.
Goloubeva, Maria: The Glorification of Emperor Leopold I in Image, Spectacle and Text, Mainz 2000 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz: Abteilung für Universalgeschichte 184).
Gordon, Donald J.: Giannotti, Michelangelo and the Cult of Brutus, in: Donald J. Gordon (Hg.): Fritz Saxl 1890–1948: A Volume of Memorial Essays from his Friends in England, London u.a. 1957, S. 281–296.
Gribbin, William: Rollin's Histories and American Republicanism, in: The William and Mary Quarterly: 3rd series 29 (1972), S. 611–622. URL: https://doi.org/10.2307/1917395 [2021-08-26]
Günther, Sven: Alter Wein in neuen Schläuchen? Römisches auf russischen Medaillen des 18. Jahrhunderts, in: MünzenRevue 44 (2012) Heft 11, S. 159–164.
Haidacher, Christoph: Maximilians Leben und Taten in 24 Bildern: Die Marmorreliefs am Grabdenkmal des Kaisers mit kunsthistorischen Beschreibungen der Reliefs von Dorothea Diemer, in: Christoph Haidacher u.a. (Hg.): Maximilian I.: Der Kenotaph in der Hofkirche zu Innsbruck, Wien 2004, S. 81–87.
Hanses, Mathias: Antikenbilder im "Federalist" / "Anti-Federalist", in: Ulrich Niggemann u.a. (Hg.): Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung 1763–1809, München 2011, S. 83–110 (Historische Zeitschrift: Beihefte 55). URL: https://doi.org/10.1515/9783110650846-007 [2021-08-26]
Hazard, Paul: Die Krise des europäischen Geistes 1680–1715, Hamburg 1939.
Hennequin, Jacques: Henri IV dans ses oraisons funèbres ou la naissance d'une légende, Paris 1977.
Herbert, Robert L.: David, Voltaire, Brutus and the French Revolution: An Essay in Art and Politics, London 1972.
Heun, Werner: Die Antike in den amerikanischen politischen Debatten in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Ulrich Niggemann u.a. (Hg.): Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung 1763–1809, München 2011, S. 65–83 (Historische Zeitschrift: Beihefte 55). URL: https://doi.org/10.1515/9783110650846-006 [2021-08-26]
Heß, Gilbert (Hg.): Graecomania: Der europäische Philhellenismus, Berlin u.a. 2009 (Klassizistisch-Romantische Kunst(t)räume 1). URL: https://doi.org/10.1515/9783110213577 [2021-08-26]
Hirschi, Caspar: Wettkampf der Nationen: Konstruktionen einer deutschen Ehrgemeinschaft an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, Göttingen 2005.
Hösch, Edgar: Die Idee der Translatio Imperii im Moskauer Russland, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2010-12-03. URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159-2010102586 [2021-08-26]
Hughes, Lindsey: Russian Culture in the Eighteenth Century, in: Dominic Lieven (Hg.): The Cambridge History of Russia, vol. 2: Imperial Russia, 1689–1917, Cambridge 2006, S. 67–91. URL: https://doi.org/10.1017/CHOL9780521815291.006 [2021-08-26]
Hünemörder, Markus: The Society of the Cincinnati: Conspiracy and Distrust in Early America, New York u.a. 2006 (European Studies in American History 2).
Hurlet, Frédéric (Hg.): Les Empires: Antiquité et Moyen Âge: Analyse comparée, Rennes 2008.
Iser, Wolfgang: Der Lesevorgang, in: Rainer Warning (Hg.): Rezeptionsästhetik: Theorie und Praxis, München 1994, S. 253–276.
Jaeger, Friedrich, Neuzeit, in: Friedrich Jaeger (Hg.): Enzyklopädie der Neuzeit, Stuttgart u.a. 2009, vol. 9, Sp. 158–181. URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_318679 [2021-08-26]
Jauß, Hans R.: Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft, in: Rainer Warning (Hg.): Rezeptionsästhetik: Theorie und Praxis, München 1994, S. 126–162.
Johnson, James W.: The Meaning of "Augustan", in: Journal of the History of Ideas 19 (1958), S. 507–522. URL: https://doi.org/10.2307/2707920 [2021-08-26]
Kersting, Wolfgang: Niccolò Machiavelli, 2. Aufl., München 1998.
Koenigsberger, Helmut G.: Dominium Regale or Dominium Politicum et Regale: Monarchies and Parliaments in Early Modern Europe, in: Helmut G. Koenigsberger: Politicians and Virtuosi: Essays in Early Modern History, London 1986, S. 1–25 (Studies Presented to the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions 69).
Konstantinou, Evangelos: Griechenlandbegeisterung und Philhellenismus, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2012-10-22. URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159-2012102202 [2021-08-26]
Kruse, Wolfgang: Die Französische Revolution, Paderborn 2005.
Kunst, Christiane: Imperium (RWG), in: Hubert Cancik u.a. (Hg.): Der Neue Pauly, Leiden 2012. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e1406210 [2021-08-26]
La Penna, Antonio: La rivista Roma e l'Istituto di Studi Romani: Sul culto della romanità nel periodo facista, in: Beat Näf (Hg.): Antike und Altertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus: Kolloquium Universität Zürich 14.–17. Oktober 1998, Mandelbachtal u.a. 2001, S. 89–123 (Texts and Studies in the History of Humanities 1).
Leone, Rossella u.a. (Hg.): Fori Imperiali: Demolizioni e scavi: Fotografie 1924/1940, Rom 2007.
Longmore, Paul K.: The Invention of George Washington, Berkeley, CA 1988.
Losemann, Volker: Sparta (RWG), Hubert Cancik u.a. (Hg.): Der Neue Pauly, Leiden 2012. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e15301520 [2021-08-26]
Mattern, Torsten: "noble beyond expression": Die Antike als Vorbild der US-Architektur, in: Ulrich Niggemann u.a. (Hg.): Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung 1763–1809, München 2011, S. 277–304 (Historische Zeitschrift: Beihefte 55). URL: https://doi.org/10.1515/9783110650846-015 [2021-08-26]
Mattingly, David J.: Imperialism, Power, and Identity: Experiencing the Roman Empire, Princeton, NJ u.a. 2011.
Middell, Matthias: Kulturtransfer und Historische Komparatistik – Thesen zu ihrem Verhältnis, in: Comparativ 10 (2000), S. 7–41. URL: https://www.comparativ.net/v2/article/view/1177 [2021-08-26]
Momigliano, Arnaldo u.a. (Hg.): Storia di Roma vol. II: L'impero mediterraneo I, La repubblica imperiale, Turin 1990.
Morley, Neville: The Roman Empire: Roots of Imperialism, London u.a. 2010. URL: https://doi.org/10.2307/j.ctt183pb5x [2021-08-26]
Morris, Ian u.a. (Hg.): The Dynamics of Ancient Empires: State Power from Assyria to Byzantium, Oxford 2009.
Moser, Florian: Extreme Metal als Medium für Vergangenheitsrepräsentationen: Altertumswissenschaftliche Sujets am Beispiel der Bands Melechesh und Nile, Diplomarbeit Innsbruck 2009.
Mossé, Claude: L'Antiquité dans la Révolution française, Paris 1989.
Münch, Paul: Das Jahrhundert des Zwiespalts: Deutsche Geschichte 1600–1700, Stuttgart 1999.
Münch, Paul: Die "Obrigkeit im Vaterstand": Zu Definition und Kritik des "Landesvaters" während der Frühen Neuzeit, in: Daphnis 11 (1982), S. 15–140.
Münkler, Herfried: Imperien: Die Logik der Weltherrschaft – vom Alten Rom bis zu den Vereinigten Staaten, Bonn 2005.
Münkler, Herfried: Machiavelli: Die Begründung des politischen Denkens der Neuzeit aus der Krise der Republik Florenz, Frankfurt am Main 1982.
Münkler, Herfried: Staatsraison und politische Klugheitslehre, in: Iring Fetscher u.a. (Hg.): Pipers Handbuch der politischen Ideen, vol. 3: Neuzeit: Von den Konfessionskriegen bis zur Aufklärung, München 1985, S. 23–72.
Mutschler, Fritz-Heiner u.a. (Hg.): Conceiving the Empire: China and Rome Compared, Oxford 2008.
Newmark, Catherine: Neustoizismus, in: Friedrich Jaeger (Hg.): Enzyklopädie der Neuzeit, Stuttgart u.a. 2009, vol. 9, Sp. 149–152. URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_318614 [2021-08-26]
Niggemann, Ulrich: Auf der Suche nach einem neuen Modell: James Harrington und die englische Republik, in: Christoph Kampmann u.a. (Hg.): Neue Modelle im Alten Europa: Traditionsbruch und Innovation als Herausforderung in der Frühen Neuzeit, Köln u.a. 2011, S. 126–139. URL: https://doi.org/10.7788/boehlau.9783412214692.126 [2021-08-26]
Niggemann, Ulrich: Von einer Oppositionsfigur zum staatstragenden Modell: Cincinnatus in der anglo-amerikanischen Publizistik des 18. Jahrhunderts, in: Ulrich Niggemann u.a. (Hg.): Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung 1763–1809, München 2011, S. 249–273 (Historische Zeitschrift: Beihefte 55). URL: https://doi.org/10.1515/9783110650846-014 [2021-08-26]
Niggemann, Ulrich u.a. (Hg.): Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung 1763–1809, München 2011 (Historische Zeitschrift: Beihefte 55). URL: https://doi.org/10.1515/9783110650846 [2021-08-26]
Niggemann, Ulrich / Ruffing, Kai: Einführung, in: Ulrich Niggemann u.a. (Hg.): Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung 1763–1809, München 2011, S. 5–22 (Historische Zeitschrift: Beihefte 55). URL: https://doi.org/10.1515/9783110650846-003 [2021-08-26]
Nippel, Wilfried: Mischverfassungstheorie und Verfassungsrealität in Antike und früher Neuzeit, Stuttgart 1980 (Geschichte und Gesellschaft: Bochumer Historische Studien 21).
Nolte, Hans-Heinrich: 1., 2., 3. Reich? – Zum Begriff Imperium, in: Hans-Heinrich Nolte (Hg.): Imperien: Eine vergleichende Studie, Schwalbach 2008, S. 5–18.
Nonn, Ulrich: Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, in: Zeitschrift für Historische Forschung 9 (1982), S. 129–142. URL: https://www.jstor.org/stable/43566968 [2021-08-26]
Oestreich, Gerhard: Antiker Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547–1606): Der Neustoizismus als politische Bewegung, hg. von Nicolette Mout, Göttingen 1989 (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 38).
Oestreich, Gerhard: Politischer Neustoizismus und Niederländische Bewegung in Europa und besonders in Brandenburg-Preußen, in: Gerhard Oestreich: Geist und Gestalt des frühmodernen Staates: Ausgewählte Aufsätze, Berlin 1969, S. 101–156.
Ozouf, Mona: La fête révolutionnaire 1789–1799, Paris 1976.
Papenheim, Martin: Die Helden Roms und die Helden Frankreichs: Die Vaterlandsliebe in Antike und Französischer Revolution, in: Francia 21,2 (1994), S. 241–244. URL: https://perspectivia.net/publikationen/francia/bsb00016313/francia-021_2-1994-00251-00254 [2021-08-26]
Parker, Harold T.: The Cult of Antiquity and the French Revolutionaries: A Study in the Development of the Revolutionary Spirit, New York, NY 1965. URL: https://archive.org/details/cultofantiquityf0000park [2021-08-26]
Pawlitzki, Brigitte: Antik wird Mode: Antike im bürgerlichen Alltag des 18. und 19. Jahrhunderts, Ruhpolding u.a. 2009.
Pesman, Roslyn: Machiavelli, Piero Soderini, and the Republic of 1494–1512, in: John M. Najemy (Hg.): The Cambridge Companion to Machiavelli, New York 2010, S. 48–63. URL: https://doi.org/10.1017/CCOL9780521861250.004 [2021-08-26]
Pocock, John G.A.: Machiavelli and Rome: The Republic as Ideal and as History, in: John M. Najemy (Hg.): The Cambridge Companion to Machiavelli, New York 2010, S. 144–156. URL: https://doi.org/10.1017/CCOL9780521861250.010 [2021-08-26]
Pocock, John G.A.: Machiavelli, Harrington and the English Political Ideologies in the Eighteenth Century, in: John G.A. Pocock: Politics, Language and Time: Essays on Political Thought and History, London 1972, S. 104–147.
Pocock, John G.A.: The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition, 2. Aufl., Princeton, NJ 2003.
Polverini, Leandro: L'impero romano – antico e moderno, in: Beat Näf (Hg.): Antike und Altertumswissenschaft in der Zeit von Faschismus und Nationalsozialismus: Kolloquium Universität Zürich 14.–17. Oktober 1998, Mandelbachtal u.a. 2001, S. 145–161 (Texts and Studies in the History of Humanities 1).
Polverini, Leandro (Hg.): Gaetano de Sanctis: La Guerra sociale, Florenz 1976.
Posener, Alan: Imperium der Zukunft: Warum Europa Weltmacht werden muss, München 2007.
Raab, Felix: The English Face of Machiavelli: A Changing Interpretation 1500–1700, London u.a. 1965.
Rahe, Paul A.: Against Throne and Altar: Machiavelli and Political Theory under the English Republic, New York, NY 2008. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9780511509650 [2021-08-26]
Riall, Lucy: Risorgimento: The History of Italy from Napoleon to the Nation State, Basingstoke u.a. 2009.
Richard, Carl J.: The Founders and the Classics: Greece, Rome, and the American Enlightenment, Cambridge, MA 1996, S. 85–122.
Rudolph, Harriet: Hercules saxonicus: Über die Attraktivität eines antiken Heros für die symbolische Absicherung einer fragilen Rangerhebung, in: Archiv für Kulturgeschichte 93 (2011), S. 57–94. URL: https://doi.org/10.7788/akg.2011.93.1.57 [2021-08-26]
Ruffing, Kai: Cato Uticensis und seine Wahrnehmung in der Antike, in: Ulrich Niggemann u.a. (Hg.): Antike als Modell in Nordamerika? Konstruktion und Verargumentierung 1763–1809, München 2011, S. 175–202 (Historische Zeitschrift: Beihefte 55). URL: https://doi.org/10.1515/9783110650846-011 [2021-08-26]
Schauerte, Thomas: Modell Germania, in: Europäische Geschichte Online, hg. v. Institut für Europäische Geschichte, Mainz 2010. URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159-2012082101 [2021-08-26]
Scheidel, Walter (Hg.): Rome and China: Comparative Perspectives on Ancient World Empires, Oxford 2009.
Schilling, Lothar: Das Jahrhundert Ludwigs XIV.: Frankreich im Grand Siècle 1598–1715, Darmstadt 2010.
Schmale, Wolfgang: Eine transkulturelle Geschichte Europas – migrationsgeschichtliche Perspektiven, in: Europäische Geschichte Online, hg. v. Institut für Europäische Geschichte, Mainz 2010. URL: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159-2010102507 [2021-08-26]
Schmitt, Arbogast: Querelle des Anciens et des Modernes (RWG), in: Hubert Cancik u.a. (Hg.): Der Neue Pauly, Leiden 2012. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e15205340 [2021-08-26]
Schulze, Hans K.: Grundstrukturen der Verfassung im Mittelalter, vol. 3: Kaiser und Reich, Stuttgart u.a. 1998.
Schulze, Hans K.: Monarchie III: Germanische, christliche und antike Wirkungsverbindung im Mittelalter, in: Otto Brunner u.a. (Hg.): Geschichtliche Grundbegriffe: Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart 1978, vol. 4, S. 141–168.
Schumacher, Leonhard: Augusteische Propaganda und faschistische Rezeption, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 40 (1988), S. 307–330. URL: https://www.jstor.org/stable/23892904 [2021-08-26]
Schumann, Jutta: Die andere Sonne: Kaiserbild und Medienstrategien im Zeitalter Leopolds I., Berlin 2003 (Colloquia Augustana 17). URL: https://doi.org/10.1524/9783050055817 [2021-08-26]
Schwager, Therese: Militärtheorie im Späthumanismus: Kulturtransfer taktischer und strategischer Theorien in den Niederlanden und Frankreich (1590–1660), Berlin 2012 (Frühe Neuzeit 160).
Schwartz, Barry: George Washington: The Making of an American Symbol, New York 1987.
Schwoerer, Lois G.: "No Standing Armies!": The Antiarmy Ideology in Seventeenth-Century England, Baltimore, MD 1974. URL: https://doi.org/10.1353/book.71702 [2021-08-26]
Scriba, Friedemann: Augustus im Schwarzhemd? Die Mostra Augustea della Romanità in Rom 1937/38, Frankfurt am Main 1995 (Italien in Geschichte und Gegenwart 2).
Seeger, Ulrike: Herkules, Alexander und Aeneas: Präsentationsstrategien der Türkensieger Prinz Eugen, Ludwig Wilhelm von Baden-Baden und Max Emanuel von Bayern, in: Christoph Kampmann u.a. (Hg.): Bourbon – Habsburg – Oranien: Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700, Köln u.a. 2008, S. 182–195.
Skinner, Quentin: The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge u.a. 1978, vol. 1–2. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9780511817878 (vol. 1) / https://hdl.handle.net/2027/heb.04034 (vol. 2) [2021-08-26]
Skinner, Quentin: Liberty before Liberalism, Cambridge 1998. URL: https://doi.org/10.1017/CBO9781139197175 [2021-08-26]
Sot, Michel: Références et modèles romains dans l'Europe carolingienne: Une approche iconographique du prince, in: Jean-Philippe Genet (Hg.): Rome et l'état moderne européen, Rom 2007 (Collection de l'Ecole Française de Rome 377).
Stachowiak, Herbert: Allgemeine Modelltheorie, Wien u.a. 1973.
Stachowiak, Herbert: Konstruierte Wirklichkeit: Zur Einleitung, in: Herbert Stachowiak (Hg.): Modelle – Konstruktion der Wirklichkeit, München 1983, S. 10–16.
Stahl, Michael: Einheit in Vielfalt: Die Friedensordnung des Imperium Romanum als erste und letzte Einheit Europas, in: Roberto Cotteri (Hg.): L'Europa multiculturale: Atti del XXIV convegno internazionale di studi italo-tedeschi, 11–13 maggio 1998, Meran 1998, S. 686–692.
Steinmetz, Willibald: Neue Wege einer historischen Semantik des Politischen, in: Willibald Seinmetz (Hg.): "Politik": Situationen eines Wortgebrauchs im Europa der Neuzeit, Frankfurt u.a. 2007, S. 9–40 (Historische Politikforschung 14).
Strothmann, Jürgen: Herrscher (RWG), in: Hubert Cancik u.a. (Hg.): Der Neue Pauly, Leiden 2012. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e1403750 [2021-08-26]
Struve, Tilman: Monarchie I. 800–1500 (RWG), in: Hubert Cancik u.a. (Hg.): Der Neue Pauly, Leiden 2012. URL: http://dx.doi.org/10.1163/1574-9347_dnp_e1504620 [2021-08-26]
Tauber, Christine: Manierismus und Herrschaftspraxis: Die Kunst der Politik und die Kunstpolitik am Hof von François Ier, Berlin 2009 (Studien aus dem Warburg-Haus 10). URL: https://doi.org/10.1524/9783050088211 [2021-08-26]
Tischer, Anuschka: Mars oder Jupiter? Konkurrierende Legitimierungsstrategien im Kriegsfall, in: Christoph Kampmann u.a. (Hg.): Bourbon – Habsburg – Oranien: Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700, Köln u.a. 2008, S. 196–211.
Visser, Romke: Fascist Doctrine and the Cult of Romanità, in: Journal of Contemporary History 27 (1992), S. 5–22. URL: https://www.jstor.org/stable/260776 [2021-08-26]
Walther, Gerrit: Renaissance, in: Friedrich Jaeger (Hg.): Enzyklopädie der Neuzeit, Stuttgart u.a. 2010, vol. 11, Sp. 1–18. URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_338623 [2021-08-26]
Walther, Gerrit: Tacitismus, in: Friedrich Jaeger (Hg.): Enzyklopädie der Neuzeit, Stuttgart u.a. 2011, vol. 13, Sp. 209–212. URL. http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_362134 [2021-08-26]
Weinbrot, Howard D.: Augustus Caesar in "Augustan" England: The Decline of a Classical Norm, Princeton, NJ 1978. URL: https://www.jstor.org/stable/j.ctt13x16zd [2021-08-26]
Wendehorst, Stephan: Vier-Reiche-Lehre, in: Friedrich Jaeger (Hg.): Enzyklopädie der Neuzeit, Stuttgart u.a. 2011, vol. 14, Sp. 324–328. URL: http://dx.doi.org/10.1163/2352-0248_edn_COM_374557 [2021-08-26]
Wiesehöfer, Josef / Rollinger, Robert: Periodisierung und Epochenbewusstsein in achaimenidischer Zeit, in: Josef Wiesehöfer u.a. (Hg.): Periodisierung und Epochenbewusstsein im Alten Testament und seinem Umfeld, Stuttgart 2012, S. 57–85 (Oriens et Occidens 20). URL: https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515104913 [2021-08-26]
Wrede, Martin: Türkenkrieger, Türkensieger: Leopold I. und Ludwig XIV. als Retter und Ritter der Christenheit, in: Christoph Kampmann u.a. (Hg.): Bourbon – Habsburg – Oranien: Konkurrierende Modelle im dynastischen Europa um 1700, Köln u.a. 2008, S. 149–165.
Wyke, Maria: Projecting the Past: Ancient Rome, Cinema and History, London u.a. 1997. URL: https://doi.org/10.4324/9781315811611 [2021-08-26]
Yates, Frances A.: Astraea: The Imperial Theme in the Sixteenth Century, London 1975.
Ziegler, Hendrik: Der Sonnenkönig und seine Feinde: Die Bildpropaganda Ludwigs XIV. in der Kritik, Petersberg 2010 (Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte 79).
Zwierlein, Cornel u.a. (Hg.): Machiavellismus in Deutschland, München 2010 (Historische Zeitschrift: Beihefte 51). URL: https://doi.org/10.1515/9783110651133 [2021-08-26]
Anmerkungen
- ^ "Was anderes nämlich ist die gesamte Geschichte als das Lob Roms?" (zitiert nach Hirschi, Wettkampf 2005, S. 195, Übersetzung ebd.).
- ^ Überblick bei Walther, Renaissance 2010, Sp. 1–5; Burke, Renaissance 1996.
- ^ Vgl. Jaeger, Neuzeit 2009, Sp. 159f.; Münch, Jahrhundert 1999, S. 165.
- ^ Dass Modelle nicht einfach Abbilder, sondern zielgerichtete Konstruktionen von Wirklichkeit sind, hat etwa Herbert Stachowiak (1921–2004) hervorgehoben – wenn auch aufgrund seines wissenschaftstheoretischen Interesses mit stärkerer Akzentsetzung bei der Repräsentativfunktion (Stachowiak, Modelltheorie 1973, S. 131ff., 287f.; Stachowiak, Wirklichkeit 1983). Den Vorbildcharakter betont hingegen aus kunsthistorischer Sicht Erben, Verständnis 2008, S. 284f.
- ^ Jauß, Literaturgeschichte 1994; Iser, Lesevorgang 1994.
- ^ Einen Überblick über den gegenwärtigen Stand bietet Schmale, Transkulturelle Geschichte 2010; sowie thesenhaft Middell, Kulturtransfer 2000, S. 17–23.
- ^ Zum vor allem in der Migrations- und Kulturtransferforschung diskutierten Konzept der Hybridität vgl. Bronfen / Marius / Steffen, Hybride Kulturen 1997.
- ^ Steinmetz, Neue Wege 2007, S. 16.
- ^ So allgemeiner auch Jauß, Literaturgeschichte 1994, S. 127f. Vgl. außerdem Niggemann / Ruffing, Einführung 2011, S. 9–14; das hier verwendete Konzept beruht auf den Überlegungen von Moser, Extreme Metal 2009, S. 15–26 und 129–131.
- ^ Vgl. Elm / Lottes / de Senarclens, Einleitung 2009, S. 9f. Klassisch zur querelle Hazard, Krise 1939, S. 56–80; sowie knapp zusammengefasst Chihaia, Querelle 2009, und Schmitt, Querelle 2012.
- ^ Vgl. hierzu Konstantinou, Griechenlandbegeisterung 2012; außerdem die Beiträge bei Heß, Graecomania 2009.
- ^ Wendehorst, Vier-Reiche-Lehre 2011; sowie Wiesehöfer / Rollinger, Periodisierung 2012, S. 81–85.
- ^ Sot, Références 2007.
- ^ Vgl. zur Problematik der Begrifflichkeit Bernstein, Anfang 2011.
- ^ Giardina / Vauchez, Mito 2008, S. 12–52; Fried, Imperium 2006, S. 15–41; und Kunst, Imperium 2012.
- ^ Giardina / Vauchez, Mito 2008, S. 61; Schulze, Grundstrukturen 1998, S. 54f.; zum Reichstitel Nonn, Heiliges Römisches Reich 1982.
- ^ Brauneder, Heiliges Römisches Reich, Sp. 317f.
- ^ Schulze, Grundstrukturen 1998, S. 55.
- ^ Haidacher, Maximilians Leben 2004, S. 87.
- ^ Dazu Tauber, Manierismus 2009, S. 268–276.
- ^ Mit Blick auf das posthume Bild Heinrichs IV. vgl. Hennequin, Henri IV 1977; und zur Herstellung eines öffentlichen Bildes von Ludwig XIV. Burke, Ludwig XIV. 1993; sowie speziell zur Verargumentierung von Antike Burke, Ludwig XIV. 1993, S. 31–52, 86f.
- ^ Vgl. zum Augustan Age und seiner Bedeutung Johnson, Meaning 1958; Weinbrot, Augustus Caesar 1978, S. 5f. Generell dazu Ayres, Classical Culture 1997.
- ^ Vgl. Bassin, Geographies 2006, S. 45f. Zur Übernahme klassizistischer Architektur und klassisch inspirierter Kunst unter Zarin Katharina II. (1729–1796) auch Hughes, Russian Culture 2006, S. 81–83; sowie zu römischen Anleihen in der Münzprägung Günther, Alter Wein 2012; generell auch Gavrilov, Rußland 2012; und Hösch, Translatio Imperii 2010.
- ^ Giardina / Vauchez, Mito 2008, S. 70ff.
- ^ Klassisch Burckhardt, Kultur der Renaissance 1988, S. 125–202.
- ^ Cipriani, Republican Ideology 1988, S. 20ff.
- ^ Baron, Crisis 1967; Skinner, Foundations 1978, vol. 1, S. 70f., 82f.
- ^ Pesman, Machiavelli 2010; Pocock, Machiavelli and Rome 2010, S. 147. Zur Krise der italienischen Republiken bereits Baron, Crisis 1967; Skinner, Foundations 1978, vol. 1, S. 113–118, 152–155.
- ^ Kersting, Machiavelli 1998, S. 48–61.
- ^ "Io non mi partirò mai, con lo esempio di qualunque cosa, da' miei Romani" ("Ich werde niemals weggehen, wie mein Vorbild in jeglicher Sache, nämlich das meiner Römer"), lässt Machiavelli seinen Protagonisten, Fabrizio Colonna, in L'arte della guerra sagen (Machiavelli, L'arte della guerra 1963, S. 501).
- ^ Machiavelli, Discorsi 1963, vol. I.4, S. 101ff. Vgl. Münkler, Machiavelli 1982, S. 378f.; Nippel, Mischverfassungstheorie 1980, S. 164.
- ^ Machiavelli, Discorsi 1963, vol. I.2, S. 95–100; und zur militärischen Expansionsfähigkeit Roms Machiavelli, Discorsi 1963, vol. I.6, S. 105–109. Vgl. Skinner, Foundations 1978, vol. 1, S. 157. Zur Wiederentdeckung der Historien des Polybios Dreyer, Polybios 2012.
- ^ Insbesondere zur Rezeption bei Livius vgl. Dreyer, Polybios 2012, Abschnitt C.1; Fuhrmann / Schmidt, Livius 2012.
- ^ Münkler, Machiavelli 1982, S. 377–380.
- ^ Vgl. zur Machiavelli-Rezeption in Deutschland insbesondere auch die Beiträge bei Zwierlein / Meyer, Machiavellismus 2010.
- ^ Vgl. Bermbach, Widerstandsrecht 1985, S. 109f.; Nippel, Mischverfassungstheorie 1980, S. 161f.; Skinner, Foundations 1978, vol. 2, S. 202ff., 214, 217–224, 230–235; Losemann, Sparta 2012.
- ^ Brutus, Vindiciae 1689 [1579], S. 185–189.
- ^ Als wahrscheinlich gelten Philippe Duplessis-Mornay (1549–1623) und Hubert Languet (1518–1581); vgl. Garnett, Introduction 1994, S. lv–lxxvi.
- ^ Es fehlt meines Wissens eine moderne Edition des lateinischen Originaltextes. Eine deutsche Übersetzung findet sich bei Dennert, Beza 1968, S. 61–202.
- ^ Vgl. Gordon, Giannotti 1957, S. 283–287.
- ^ Heinrich II. von Frankreich, Sendschrifften der Königlichen Maiestat zu Franckreich 1552.
- ^ Schauerte, Modell Germania 2012.
- ^ Vgl. Dreitzel, Monarchiebegriffe 1991, vol. 1, S. 57ff.; Struve, Monarchie 2012, Abschnitt I.C.; sowie zur Rezeption der antiken Staatsformenlehre im 13. Jahrhundert Schulze, Monarchie 1978, S. 165f.
- ^ Conze, Monarchie 1978, S. 170.
- ^ Bodin, Six livres 1593, S. 320f. Vgl. Conze, Monarchie 1978, S. 170.
- ^ Münch, Jahrhundert 1999, S. 67–71, 102ff.; Münch, Obrigkeit 1982; Conze, Monarchie 1978, S. 175f.
- ^ Vgl. etwa Brockmann, Bild des Hauses Habsburg 2008, S. 31.
- ^ Vgl. etwa Seeger, Herkules 2008; Burke, Ludwig XIV. 1993, S. 101f.; und allgemein Strothmann, Herrscher 2012. Unter dem Einfluss der Querelle des Anciens et des Modernes konnten freilich die zeitgenössischen Herrscher zunehmend den antiken als überlegen dargestellt werden; vgl. Burke, Ludwig XIV. 1993, S. 154f. und 159f.
- ^ Tischer, Mars 2008; Seeger, Herkules 2008; Rudolph, Hercules 2011; Goloubeva, Glorification 2000, S. 132, 138f., 145; Schumann, Sonne 2003, S. 267f., 291, 334, 381; Wrede, Türkenkrieger 2008, S. 155.
- ^ Das gilt besonders für die ersten zwei Regierungsjahrzehnte; vgl. Burke, Ludwig XIV. 1993, S. 39–46; Ziegler, Sonnenkönig 2010, S. 44–48; Schilling, Jahrhundert 2010, S. 127f.
- ^ Yates, Astraea 1975. Astraea war in der griechischen Mythologie eine Tochter von Zeus und galt als Personifikation der Gerechtigkeit und Unschuld. Sie verließ die Menschen aufgrund deren Verderbtheit während des Ehernen Zeitalters und verwandelte sich in das Sternbild der Jungfrau. Sollte sie zu den Menschen zurückkehren, würde dies die Wiederkehr des Goldenen Zeitalters ankündigen.
- ^ Münkler, Staatsraison 1985, S. 59ff.; Walther, Tacitismus 2011.
- ^ Klassisch hierzu Oestreich, Antiker Geist 1989; Oestreich, Politischer Neustoizismus 1969. Vgl. zum Neostoizismus auch Münkler, Staatsraison 1985, S. 61–67; Schwager, Militärtheorie 2012, S. 116–142; und zusammenfassend Newmark, Neustoizismus 2009.
- ^ Dazu jetzt umfassend Schwager, Militärtheorie 2012, S. 91–289; sowie zur Forschungsgeschichte Schwager, Militärtheorie 2012, S. 4–52.
- ^ Vgl. Koenigsberger, Dominium Regale 1986.
- ^ Auf einige Beispiele aus der Tudorzeit, die freilich im Kontext der Bürgerkriege wenig rezipiert wurden, verweist Nippel, Mischverfassungstheorie 1980, S. 177–210.
- ^ Nippel, Mischverfassungstheorie 1980, S. 255f. Zum Übergang zu einer an Polybios orientierten politischen Sprache vgl. Pocock, Machiavellian Moment 2003, S. 354f. und 361–371.
- ^ Harrington, Oceana 2003, S. 10. Vgl. auch Fink, Classical Republicans 1962, S. 53; Raab, English Face 1965, S. 187–192; Pocock, Machiavellian Moment 2003, S. 383–400; Pocock, Machiavelli 1972, S. 104–147.
- ^ Vgl. Pocock, Machiavellian Moment 2003, S. 380–400; Schwoerer, Standing Armies 1974; Skinner, Liberty 1998, S. 73f.
- ^ Eine Ausnahme ist Nedham, Excellencie 1767 [1656], S. xi. Vgl. Pocock, Machiavellian Moment 2003, S. 382.
- ^ Zur Machiavelli-Rezeption in England vgl. Raab, English Face 1965; Pocock, Machiavellian Moment 2003; Rahe, Against Throne and Altar 2008.
- ^ Ediert bei Robbins, Republican Tracts 1969.
- ^ Vgl. insbesondere Claydon, William III 1996; sowie Goldie, Revolution 1980.
- ^ Zunächst im London Journal, dann im British Journal erschienen und später gesammelt unter dem Titel Cato's Letters publiziert: Trenchard / Gordon, Cato's Letters 1995.
- ^ Vgl. Burtt, Virtue 1992; Pocock, Machiavellian Moment 2003, S. 462–505; und zum Korruptionsbegriff Euben, Corruption 1989.
- ^ Addison, Cato 2004.
- ^ Bolingbroke, Political Writings 1997, S. 128f.
- ^ Bolingbroke, Political Writings 1997., S. 129ff. Zu Harrington vgl. Niggemann, Auf der Suche 2011.
- ^ Zum abwägenden Umgang mit Antike etwa in den Federalist Papers vgl. Hanses, Antikenbilder 2011; sowie allgemeiner Heun, Antike 2011.
- ^ Rollin, Roman History 1739–1750. Zur Rezeption des ursprünglich in französischer Sprache publizierten Werks in England und Amerika vgl. Gribbin, Histories 1972; Richard, Founders 1996, S. 54f. Generell zur Bedeutung von Livius für den frühneuzeitlichen Republikanismus Skinner, Liberty 1998, S. 44ff.
- ^ Hanses, Antikebilder 2011, S. 87f.
- ^ Mossé, L'Antiquité 1989, S. 40–61.
- ^ Vgl. Papenheim, Helden 1994; Ozouf, Fête 1976, S. 329–332.
- ^ Desmoulins, Le Vieux Cordelier 1837.
- ^ Babeuf, Textes 1965, S. 204–219.
- ^ Parker, Cult 1965, S. 16–20.
- ^ Vgl. zum 18. Brumaire Kruse, Französische Revolution 2005, S. 45f.
- ^ Machiavelli, Discorsi 1963, vol. I.17, S. 137ff.
- ^ Bolingbroke, Political Writings 1997, S. 129ff., 167f.
- ^ Voltaire, Brutus 1998. Vgl. auch die Einleitung von John Renwick inVoltaire, Brutus 1998, S. 77–113.
- ^ Zum Gemälde, seiner Entstehung und Wirkung vgl. Herbert, David 1972.
- ^ Addison, Cato 2004.
- ^ Zur Wertschätzung durch Washington vgl. Longmore, Invention 1988, S. 173f.; Schwartz, Washington 1987, S. 130; Ferling, First of Men 1988, S. 6; und zur Aufführung Furtwangler, Cato 1980. Generell zu Cato in der Amerikanischen Revolution Clark, Cato 2011; sowie Bailyn, Origins 1977, S. 44.
- ^ Niggemann, Oppositionsfigur 2011; Hünemörder, Society of the Cincinnati 2006. Zur Cincinnatus-Rezeption in Frankreich vgl. Parker, Cult 1965, S. 24, 144 und 147.
- ^ Vgl. Ruffing, Cato Uticensis 2011; und Dunsch, Exemplo aliis esse debetis 2011.
- ^ Skinner, Liberty 1998.
- ^ Zu den antiken Tugenddiskursen Bücher, Geschichte 2006; sowie mit Blick auf die Französische Revolution Parker, Cult 1965, S. 23ff.
- ^ Vgl. etwa Mattern, "noble beyond expression" 2011. Für die Kunst wäre ferner auf Johann Joachim Winckelmann (1717–1768) zu verweisen, in der Kleidung und im Mobiliar auf den von Frankreich ausgehenden Empire-Stil; vgl etwa Pawlitzki, Antik wird Mode 2009.
- ^ So auch Ozouf, Fêtes 1976, S. 332f.
- ^ Vgl. Burckhardt, Fragmente 1957, S. 13f.
- ^ Poesche / Goepp, New Rome 1853, S. 9: "If we search the history of the past for a parallel to the present aspect of political relations, we find it in the time when Greece had just passed the meridian of her glory, when Macedon had awakened to a consciousness of her powers, and the Roman republic was mewing her wings for a flight destined to outstrip them both."
- ^ So der treffende Untertitel des Bandes II.1 der Storia di Roma: Momigliano / Schiavone, Storia 1990. Zu den von Poesche und Goepp formulierten Positionen vgl. schon Gollwitzer, Geschichte 1972, S. 489ff.
- ^ Vgl. die Beiträge in Niggemann / Ruffing, Antike 2011.
- ^ Vgl. Günther, Alter Wein 2012, S. 159f.
- ^ Vgl. Wyke, Projecting the Past 1997, S. 15ff.
- ^ Vgl. Ferguson, Imperium 2004. Vgl. dazu auch Morley, Empire 2010, S. 6ff. Die aktuelle Diskussion in der Geschichtswissenschaft um die historische Kategorie Imperium, die in Deutschland wesentlich durch die Veröffentlichung der Monographie von Herfried Münkler (*1951) angestoßen wurde, ist vor allem vor diesem Hintergrund zu sehen (vgl. Münkler, Imperien 2005; Nolte, Reich 2008; Mutschler / Mittag, Conceiving the Empire 2008; Morris / Scheidel, Dynamics 2009; Scheidel, Rome 2009; Hurlet, Empires 2008; Bang / Bayly, Empires 2011.
- ^ Vgl. Wyke, Projecting the Past 1997, S. 131–137.
- ^ Vgl. Christ, Geschichte 2009, S. 10f.
- ^ So etwa Alföldy, Imperium 1999, S. 48: "Rom vollbrachte die historische Leistung, einen Vielvölkerstaat zu errichten, in dem Völker, die nicht nur mit den Römern, sondern auch untereinander viele Kriege ausgetragen hatten, jahrhundertelang miteinander in Frieden lebten. Sie wurden 'Römer', ohne ihr eigenes Profil zu verlieren; ihre eigenen Leistungen bereicherten das Imperium. Zu verdanken war Roms Erfolg nicht nur der wirtschaftlichen 'Globalisierung', sondern vor allem auch der politischen Integration der einzelnen Völker und Regionen in den Römerstaat und der Überlegenheit seines geistigen Fundaments, der griechisch-römischen Kultur. Ein in der Geschichte zuvor nie dagewesenes und auch bis heute nicht wiederholtes Experiment war gelungen." – Vgl. so auch Stahl, Einheit 1998.
- ^ Vgl. Posener, Imperium 2007.
- ^ Vgl. Morley, Empire 2010, S. 9, mit dem besagten Zitat.
- ^ Vgl. Mattingly, Imperialism 2011, S. 10.
- ^ Vgl. dazu Riall, Risorgimento 2009, S. 149f. und 155; sowie Bondanella, Eternal City 1987, S. 158–165.
- ^ Vgl. Polverini, Gaetano de Sanctis 1976, S. XXXVff.; Gabba, Storia di Roma 1988, S. 181; Gabba, Cesare e Augusto nella storiografia 1989, bes. S. 51f.; Gabba, Cesare e Augusto nell' opera 1989; Bondanella, Eternal City 1987, S. 165f.; Wyke, Projecting the Past 1997, S. 18; Bandelli, Mito 2001, S. 125–134; Giardina / Vauchez, Mito 2008, S. 181–185.
- ^ Zur Geschichte dieses Zeitraums vgl. Bosworth, Italy 1983, S. 99–120; Bosworth, Italy 1996, S. 22–29 sowie 103f.
- ^ Vgl. Visser, Fascist Doctrine 1992, S. 7f. Vgl. ferner Giardina / Vauchez, Mito 2008, S. 196–199.
- ^ "Jeder von euch soll auf zwei festen Beinen stehen und mit lauter Stimme die römische Parole wiederholen, die Parole der Legionäre: hier bleiben wir am besten." Vgl. die sich selbst irredentistisch gebärdende und in wissenschaftlicher Hinsicht gewiss problematische Monographie von Gatta, Italia 2007, S. 223–249, besonders S. 235 mit dem Zitat D'Annunzios.
- ^ Vgl. dazu Schumacher, Propaganda 1988; Visser, Fascist Doctrine 1992; Scriba, Augustus 1995. Zum Themenkomplex Faschismus und Antike, insbesondere dem Bezug auf Rom vgl. Cagnetta, Antichisti 1979; Bondanella, Eternal City 1987, S. 172–206; Wyke, Projecting the Past 1997, S. 20ff.; Bandelli, Mito 2001, S. 134–144; La Penna, Rivista 2001; Polverini, L'impero 2001.
- ^ Vgl. Bertelli, Piazza Venezia 1997, S. 191f.; Leone / Margiotta, Fori 2007; Giardina / Vauchez, Mito 2008, S. 212–272. Zu den Grabungen in Pompeji vgl. Conticello, Scienze 1994, S. 22ff. – Vgl. ferner Brice, Vittoriano 1998, S. 330–364.
- ^ Die romanità des Dichters wird noch heute auf der Internetseite des Quirinale hervorgehoben.