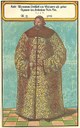Einleitung
Im Zuge des viel beschriebenen spatial turn hat in den Geistes- und Sozialwissenschaften in den vergangenen Jahren auch das Interesse an der Geschichte kollektiver Vorstellungen von der Unterteilung des europäischen Kontinents in geographische bzw. historische Großregionen zugenommen.1 Untersuchungen zur Konstruktion Europas als imaginierter Geschichts- und Kulturraum bzw. zur "Erfindung" und "Vorstellung" des "Nordens", des "Balkans" oder des östlichen Europa lassen sich dem expandierenden Feld einer kulturwissenschaftlichen Mental-Maps-Forschung zurechnen. Das Konzept der mental map (kognitive Landkarte), das aus der Kognitionspsychologie entlehnt ist, korrespondiert dabei nicht mit einer klar definierten Untersuchungsmethode oder Theorie. Die heuristischen Instrumente, die in der historischen Mental-Maps-Forschung zur Anwendung kommen, sind vielmehr benachbarten Feldern wie der Grenzen- und Stereotypen-Forschung, der Diskursgeschichte, der Kartographie-Geschichte oder der Geschichte des Reisens und des Reiseberichts entlehnt. Im folgenden Beitrag soll das Konzept der cognitive / mental map kurz skizziert und sein heuristisches Potential für die historische Forschung ausgeleuchtet werden. Nach einem kurzen Überblick zum Stand der europabezogenen Mental-Maps-Forschung wird am Beispiel der "Erfindung" bzw. Konstruktion Osteuropas ein besonders intensiv diskutierter Gegenstand dieses Forschungsgebiets vorgestellt.
Begriffsdefinition mental map / kognitive Landkarte
Das Konzept der kognitiven Landkarte, das mittlerweile auch Eingang in die Geographie, die Geschichtswissenschaften und die Kulturanthropologie gefunden hat, stammt ursprünglich aus der Kognitionspsychologie. Der Begriff cognitive map geht auf den US-amerikanischen Psychologen Edward C. Tolman (1886–1959) zurück, der sich in seinen Forschungen mit dem Orientierungssinn von Ratten beschäftigte und in diesem Zusammenhang auch Überlegungen zur Repräsentation räumlichen Wissens im menschlichen Gehirn anstellte.2 Nicht zuletzt durch Beiträge aus der Geographie und Stadtplanung etablierte sich das Konzept der cognitive oder mental map in den 1960er Jahren als Paradigma einer interdisziplinären Forschung zum räumlichen Orientierungsvermögen des Menschen.3
beschäftigte und in diesem Zusammenhang auch Überlegungen zur Repräsentation räumlichen Wissens im menschlichen Gehirn anstellte.2 Nicht zuletzt durch Beiträge aus der Geographie und Stadtplanung etablierte sich das Konzept der cognitive oder mental map in den 1960er Jahren als Paradigma einer interdisziplinären Forschung zum räumlichen Orientierungsvermögen des Menschen.3
Mit dem abstrakten Begriff "kognitives Kartieren" werden in der einschlägigen Forschungsliteratur jene kognitiven oder geistigen Fähigkeiten zusammengefasst, "die es uns ermöglichen, Informationen über die räumliche Umwelt zu sammeln, zu ordnen, zu speichern, abzurufen und zu verarbeiten."4 Kognitive Landkarten sind demnach Repräsentationen räumlichen Wissens im menschlichen Gehirn. Diese lassen sich als subjektive Vorstellungen räumlicher Gegebenheiten beschreiben, die vom individuellen Standpunkt, Blickwinkel und Bewegungsradius abhängen und die Welt so abbilden, wie sie sich dem jeweiligen Beobachter darstellt.5 Eine kognitive Landkarte hilft dem Menschen, sich in seiner räumlichen Umgebung zu orientieren. Sie "spiegelt die Welt so wider, wie ein Mensch glaubt, dass sie ist, sie muss nicht korrekt sein. Tatsächlich sind Verzerrungen sehr wahrscheinlich."6
Während sich in der psychologischen Forschung der Begriff der cognitive map (bzw. des cognitive mapping) durchgesetzt hat, ist in der Geographie eher das Konzept der mental map (bzw. des mental mapping) gebräuchlich.7 Die Beschreibung mentaler Repräsentationen räumlicher Strukturen als "Landkarte" ist dabei nicht unumstritten.8 So sind in der Orientierungsforschung auch noch andere Bezeichnungen gebräuchlich, wie z.B. environmental images,9 spatial representations, topological schemata und viele andere.10 In der historischen Forschung zu kollektiven Vorstellungen von geographischen und historischen Großräumen hat sich hingegen der Begriff der mental map weitgehend etabliert.11
Zur Karriere eines Konzepts in der Geschichtswissenschaft
Bereits die "klassische" Mental-Maps-Forschung hat darauf hingewiesen, dass kognitive Karten neben "Lageinformationen" (locational information) zur Richtung und zum Ort der repräsentierten Objekte auch Informationen über deren "qualitative Eigenschaften" enthalten.12 "Cognitive Maps are not just a set of spatial mental structures denoting relative position, they contain attributive values and meanings."13 Diese Beobachtung zu kognitiven Landkarten im Allgemeinen hat in einem besonderen Maße für jene Repräsentationen von Räumen Gültigkeit, mit denen sich die historische Mental-Maps-Forschung seit einiger Zeit beschäftigt. Wenn beispielsweise nach der Genese und der Wirkmächtigkeit westlicher Balkan-Bilder gefragt wird, so richtet sich der Blick gerade auf jene "attributive values and meanings", die mit diesen Raumvorstellungen verknüpft sind.14
Die normative Aufladung kognitiver Karten ist einer der Gründe für die Anschlussfähigkeit des Konzepts der mental maps für historische Fragestellungen.15 Während sich jedoch die kognitionspsychologische oder geographische Forschung vor allem damit befasst, welche Rolle kognitive Karten für die individuelle räumliche Orientierung spielen, zielt die kulturwissenschaftliche und historische Mental-Maps-Forschung in eine andere Richtung. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, wie persönliche Raumvorstellungen durch kulturell vermittelte (Welt-)Bilder beeinflusst werden und wie kollektiv geteilte Repräsentationen einer – erfahrenen oder imaginierten – räumlichen Umwelt auf Prozesse kultureller Gemeinschafts- und Identitätsbildung zurückwirken. Während die Abhängigkeit individueller Raum-Repräsentationen von kulturellen, sozialen und geschlechtsspezifischen Parametern in der kognitionspsychologischen Forschung mittlerweile mit reflektiert wird, weist die Frage nach dem Einfluss kollektiver Raumvorstellungen auf historische Prozesse der Gemeinschaftsbildung über die "klassische" Mental-Maps-Forschung hinaus.16 Wenn in historischen Studien z.B. nach der "Erfindung Osteuropas"17 gefragt wird, geht es nicht in erster Linie darum, entsprechende Raumbilder mit einer "objektiven Wirklichkeit" abzugleichen. Vielmehr werden die in diesen Vorstellungen manifesten Repräsentationen der räumlichen Umwelt als eigene historische "Wirklichkeit" ernst genommen und nach ihrer handlungsleitenden Kraft für historische Akteure befragt.
Obwohl sich "klassische" und historische Mental-Maps-Forschung in wichtigen theoretischen Vorannahmen berühren, unterscheiden sie sich nicht zuletzt hinsichtlich ihres methodischen Vorgehens. Während in Psychologie und Geographie vor allem nach mentalen Repräsentationen individueller environments ("Nah-Räume" wie Arbeits- und Schulwege, Stadtviertel etc.) gefragt wird, befasst sich die historische Mental-Maps-Forschung mit Repräsentationen räumlich-sozialer Zusammenhänge, "die weit über die Erfahrungsgrenzen des Individuums hinausreichen" (etwa "Europa", "der Westen", "der Orient" etc.).18 Zudem haben Kognitionspsychologen die Möglichkeit, Probanden nach individuellen Raumbildern zu befragen oder Pläne von erfahrenen und imaginierten Räumen zeichnen zu lassen, während Historiker auf überliefertes Material angewiesen sind, um Raumbilder einer bestimmten Person oder Gruppe rekonstruieren zu können. Als Quellen bieten sich hier geographische und kulturhistorische Länderdarstellungen (Chorographien), Reiseberichte![Johann Reinhold (1729–1798) und Georg Forster (1754–1794) in Tahiti John Francis Rigaud (1742–1810), Johann Reinhold und Georg Forster in Tahiti, o. J. [zwischen 1775–1780]; Bildquelle: Privatbesitz [wikimedia commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forsterundsohn.jpg?uselang=de.]](./illustrationen/anglophilie-bilderordner/johann-reinhold-172920131798-und-georg-forster-175420131794-in-tahiti/@@images/image/thumb) und Reiseführer, sowie Korrespondentenberichte aus dem Ausland, Landkarten, Karikaturen und anderes Bildmaterial an, wobei sich die historische Mental-Maps-Forschung in den vergangenen Jahren vor allem mit textlich vermittelten Raumvorstellungen beschäftigt hat. Diese Fixierung auf diskurshistorische Fragestellungen hat ihr die Kritik eingebracht, sie vernachlässige visuelles Quellenmaterial und konzentriere sich zu sehr auf die Rekonstruktion kognitiver Landkarten sozialer Eliten.19 Allerdings lässt sich in der historischen Forschung seit einiger Zeit auch ein verstärktes Interesse an Landkarten als Quellen für die Rekonstruktion vergangener Raumvorstellungen
und Reiseführer, sowie Korrespondentenberichte aus dem Ausland, Landkarten, Karikaturen und anderes Bildmaterial an, wobei sich die historische Mental-Maps-Forschung in den vergangenen Jahren vor allem mit textlich vermittelten Raumvorstellungen beschäftigt hat. Diese Fixierung auf diskurshistorische Fragestellungen hat ihr die Kritik eingebracht, sie vernachlässige visuelles Quellenmaterial und konzentriere sich zu sehr auf die Rekonstruktion kognitiver Landkarten sozialer Eliten.19 Allerdings lässt sich in der historischen Forschung seit einiger Zeit auch ein verstärktes Interesse an Landkarten als Quellen für die Rekonstruktion vergangener Raumvorstellungen beobachten.20
beobachten.20
Eine offene Frage ist schließlich, inwiefern auch Historiker, die sich mit der Geschichte einer bestimmten historischen Großregion befass(t)en, zur Reifikation tradierter Raumvorstellungen beitragen. Regionalwissenschaftliche historische Teildisziplinen wie z.B. die Osteuropäische Geschichte waren in der Vergangenheit vielfach darum bemüht, den eigenen Forschungsgegenstand als gleichsam "objektiv" gegebene historische Tatsache zu beschreiben, auch um daraus ihre Existenzberechtigung als eigenständiges universitäres Fach abzuleiten.21 In der lebhaft geführten Debatte über die Konstruktion des westlichen Balkan-Bildes Ende der 1990er Jahre wurde der historischen Südosteuropa-Forschung beispielsweise der Vorwurf gemacht, sie schreibe sich in eine lange Tradition tendenziöser westlicher Diskurse über diese Region ein und trage mit ihren regionalhistorischen Studien zur Verfestigung stereotyper Raumvorstellungen bei.22 Dieser Position wurde wiederum entgegengehalten, das Nachdenken über regional divergierende Entwicklungsprozesse gehöre zu den Kernaufgaben historischer Forschung und die Diagnose struktureller Differenz verschiedener europäischer Regionen sei nicht mit einem normativen westlichen Diskurs des "Balkanismus" gleichzusetzen.23
Die hier angesprochene Debatte berührte letztlich die Frage, inwieweit Historiker wertfreie Aussagen über Differenz und über "objektive" historische Strukturgrenzen in der europäischen Geschichte machen können, ohne sich dabei selbst in traditionellen mental maps zu verfangen und diese zu perpetuieren.24 In der Diskussion über den westlichen Südosteuropa-/Balkan-Begriff ließ sich am Ende eine Annäherung der divergierenden Standpunkte beobachten: Während die eine Seite anerkannte, auch in der Geschichtswissenschaft müsse über die Wirkmächtigkeit kognitiver Karten nachgedacht werden, konzedierte die andere, dass sich strukturelle Differenz in der heutigen kulturellen und politischen Entwicklung in Europa auch mit Blick auf ein unterschiedliches "historisches Erbe" bzw. "Vermächtnis" der jeweiligen Geschichtsregionen erklären lasse.25
Fallbeispiel: "Osteuropa" als Gegenstand der historischen Mental-Maps-Forschung
Die Forschungsliteratur zur Geschichte kognitiver Landkarten Europas und seiner Großregionen ist kaum mehr zu überblicken. Sowohl die Geschichte Europas als vorgestellter und "erfundener" Kulturraum als auch die Diskurs- und Wahrnehmungsgeschichte der wichtigsten europäischen Großregionen wie Südeuropa, Westeuropa, Nordeuropa / Skandinavien, Mitteleuropa / Ostmitteleuropa, Südosteuropa / Balkan und Osteuropa sind mittlerweile intensiv untersucht worden.26 Am Fallbeispiel der "Erfindung" Osteuropas soll im Folgenden der Forschungsstand zur Geschichte einer wichtigen europäischen Großregion zusammenfassend skizziert werden.
Wo liegt "Osteuropa"?
Beim Versuch, "Osteuropa" auf den mental maps des europäischen Kontinents zu lokalisieren, wird man schnell mit dem Problem konfrontiert, dass die Begriffe "Osteuropa", "Eastern Europe", "L' Europe orientale", "Vostočnaja Evropa", "Europa wschodnia" etc. in den einzelnen europäischen Sprachen verschieden stark verankert sind und zudem unterschiedlich eng umgrenzte Räume bezeichnen. Während die aktuelle Ausgabe der Brockhaus Enzyklopädie beispielsweise einen eigenen Eintrag mit dem Titel "Osteuropa" enthält, fehlt das Stichwort "Eastern Europe" in der Encyclopedia Britannica.27 "Im allgemeinen geographischen Sprachgebrauch", so ist dem Brockhaus zu entnehmen, zählen zu "Osteuropa" die "Länder im Osten Europas, also Litauen, Lettland, Estland, Weißrussland, Moldova, die Ukraine und der europäische Teil Russlands". Gleichzeitig wird jedoch betont, dass der gängige deutsche Osteuropa-Begriff alle "Gebiete östlich der (historischen) deutschen Sprachgrenze ohne regionale oder ethnische Differenzierung" umfasse.28
Nach der Definition des Amtes für Statistik der Vereinten Nationen (UNSTATS) zählen zu "Eastern Europe" neben der Russischen Föderation, der Ukraine, Weißrussland und Moldova auch Bulgarien, Rumänien, Tschechien, Ungarn, Polen und die Slowakei.29 Im World Factbook der Central Intelligence Agency (CIA) wird die Russische Föderation dagegen "Central Asia" zugerechnet, während die Ukraine und Weißrussland als Teil von "Europe" gelten.30 Im Sprachgebrauch der EU-Administration firmieren schließlich Russland, Weißrussland, die Ukraine und Moldova als "other European countries".31
Diese Auflistung, die beliebig verlängert werden könnte, veranschaulicht, in welch hohem Maße gesellschaftliche mental maps vom politischen Standpunkt und disziplinären Blickwinkel der jeweiligen Beobachter abhängig sind. Selbst innerhalb regionalwissenschaftlicher Fachdisziplinen wie der Osteuropäischen Geschichte herrscht alles andere als Einigkeit darüber, wo die geographischen und geschichtsräumlichen Grenzen des eigenen Untersuchungsgegenstands verlaufen. Während Historiker in der englischsprachigen Welt, die sich mit "Eastern Europe" befassen, Expertise für die Geschichte von Ländern wie Polen, Tschechien, Ungarn etc. beanspruchen, schlägt die deutschsprachige Osteuropaforschung diese Länder gewöhnlich der Geschichtsregion "Ostmitteleuropa" zu. Russland bzw. die Sowjetunion (zum Teil auch der ganze ostslawische bzw. orthodoxe Kulturraum) wird dagegen als "Osteuropa im engeren Sinne" betrachtet.32 Das hier gezeichnete Bild wird noch komplizierter und unübersichtlicher, berücksichtigt man zusätzlich die historische Tiefendimension, das heißt die Entwicklungsgeschichte des (westlichen) Osteuropa-Begriffs. So wirken in vielen Ländern bis heute die mental maps des Kalten Krieges und die Gleichsetzung von "Osteuropa" und "Ostblock" nach.
Bei einer Analyse des heutigen Osteuropa-Begriffs fällt schließlich auf, dass er in erster Linie als Fremdbezeichnung eines "anderen" und "fremden" Großraums gebräuchlich ist. Dieser wird vage "östlich" des "eigenen" Territoriums verortet und häufig mit negativen Attributen verknüpft. Während im Deutschen der Begriff "Osteuropa" landläufig einen politischen und kulturellen Raum bezeichnet, der an der Grenze von Oder und Neiße bzw. am zwischen Deutschland, Österreich und Tschechien gelegenen Böhmerwald beginnt,33 fühlen sich Polen, Tschechen und Ungarn in der Regel nicht in Ost-, sondern in (Ost-)Mitteleuropa zuhause. Noch in der Ukraine und in Weißrussland ist die Vorstellung verbreitet, man lebe nicht in Ost-, sondern zwischen West- und Osteuropa.34 Noch weiter östlich, in Russland, wird zwar seit mehreren Jahrhunderten intensiv über das eigene Verhältnis zum "Westen" (zapad) nachgedacht, Russland wurde und wird in diesen Debatten jedoch nicht "Osteuropa" zugerechnet.35 Der Begriff "Osten" (vostok) bezeichnet im Russischen traditionellerweise den "Orient".36 Auf russischen mental maps wird das eigene Land seit dem 19. Jahrhundert daher entweder als eigene kulturräumliche Entität (so etwa in der Debatte über "Russland und Europa"37)oder als Teil des orthodoxen (also "rechtgläubigen") bzw. des slawischen Kulturraums definiert, beispielsweise von den als "Slawophile" bekannten Vorläufern des Panslawismus. Seit dem 20. Jahrhundert wird das Gebiet zudem als Teil "Eurasiens" bzw. der "fortschrittlichen (sozialistischen) Welt" verzeichnet.38 Als vermutlich einzige europäische Großregion zeichnet sich "Osteuropa" dadurch aus, dass es zwar auf den kognitiven Landkarten vieler Menschen fest verankert ist, es jedoch wenige Menschen gibt, die diese "Fremdverortung" für sich selbst akzeptieren.39 Osteuropa ist daher eine Großregion ohne "Osteuropäer". Restaurants etwa, die in Polen, Ungarn oder Russland mit "osteuropäischer Küche" werben, haben aus diesem Grund Seltenheitswert.
etwa, die in Polen, Ungarn oder Russland mit "osteuropäischer Küche" werben, haben aus diesem Grund Seltenheitswert.
Zur Geschichte des westlichen Osteuropa-Begriffs
Die Konvention, Europa gedanklich in eine westliche und eine östliche Hälfte zu teilen, ist historisch gesehen relativ jung. Erst um das Jahr 1800 verlor das antike Weltbild an Bedeutung, das von einer Unterteilung des Kontinents in einen "zivilisierten" Süden und einen "barbarischen" Norden ausging.40 In der Geographie und Länderkunde des deutschen, englischen und französischen Sprachraums galt Russland beispielsweise noch bis Anfang des 19. Jahrhunderts als "nordisches" Land. So ist bereits Mitte der 1980er Jahre dargelegt worden, dass das Zarenreich im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts auf den westlichen mental maps gewissermaßen vom "Norden" in den "Osten" Europas wanderte.41 Bei diesem Vorgang handelte es sich nicht nur um eine terminologische Veränderung. Vielmehr spiegelte "sich darin der Wandel des politisch-ideologischen Weltbildes weiter Teile Europas [wider]".42
Nach dem Wiener Kongress, so derselben Argumentation weiter folgend, stieg Russland zum Garanten der ancien régimes und zum antirevolutionären "Gendarm" Europas auf, eine Entwicklung, die insbesondere in liberalen Kreisen im westlichen Europa mit Argwohn beobachtet wurde.43 Negative Attribute, die im westlichen Orient-Diskurs vormals den Völkern des "Ostens" zugeschrieben wurden, finden sich seit dem frühen 19. Jahrhundert verstärkt auch in Russland-Beschreibungen wieder. Durch Hinweise auf den "barbarischen", "wilden" und "halb-asiatischen" Charakter des Zarenreiches verfestigte sich die Vorstellung von Russland als "östliches" Land. Da das Zarenreich bis 1917 weite Teile Ostmitteleuropas beherrschte, wurden in den westlichen Sprachen die Begriffe "Russland" und "Osteuropa" bis zum Ende des Ersten Weltkrieges häufig synonym gebraucht.
Zu den Verschiebungen auf den europäischen mental maps zu Beginn des 19. Jahrhunderts trug auch die Einengung der Begriffe "Norden" und "Nordeuropa" auf die Länder Skandinaviens bei, die unter anderem durch die germanische Philologie und Altertumswissenschaft und durch die Bewegung des "Skandinavismus" in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vorangetrieben wurde. Zeitgleich definierte die sich ausdifferenzierende Sprach- und Literaturwissenschaft das Verbreitungsgebiet der slawischen Sprachen als eine eigenständige kulturräumliche Einheit, eine Vorstellung, die den westlichen Osteuropa-Begriff bis heute prägt.
Die mentale Verortung des Zarenreiches im Osten Europas, die sich begriffsgeschichtlich auf das erste Drittel des 19. Jahrhunderts datieren lässt, knüpfte jedoch auch an ältere raumbezogene Diskurse und Vorstellungen an. Hinzuweisen ist hier z.B. auf die traditionelle, bis in die Antike zurückreichende Zuordnung der orthodoxen Christen zur Welt der "nationes christianorum orientalium", das heißt der nichtlateinischen "orientalischen" bzw. "morgenländischen" "(Ost)kirche" (ecclesia orientalis).44 In dieser Hinsicht war Alt-Russland bzw. die Kiever Rus' bereits seit der Christianisierung durch Vladimir I. Sviatoslavič (956–1015), genannt der Heilige Vladimir, im 10. Jahrhundert Teil der "östlichen" christlichen Welt. Auch die Entwicklung, dass Russland vormals "nördliche Attribute" wie "barbarischer Charakter", "Horden" sowie die westliche Angst vor einer "Flut" aus dem entsprechenden Raum zugeschrieben wurden, liegt länger zurück, obwohl sie mit der Genese unseres heutigen Osteuropa-Begriffs in Verbindung gebracht wird. Seit der Frühen Neuzeit und der "Wiederentdeckung" des Zarenreiches durch Reisende und Diplomaten wie Sigmund von Herberstein (1486–1566)[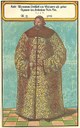 ] oder Adam Olearius (ca. 1603–1671)[
] oder Adam Olearius (ca. 1603–1671)[ ] zählt der Hinweis auf den "barbarischen" und "halb-asiatischen" Charakter Russlands und seiner Bewohner zu den hartnäckigen Klischees des westlichen Russland-Bildes.45 Aus diesem Grund erscheint es lohnend und plausibel, die Wurzeln unserer heutigen Vorstellung von "Osteuropa" in einer Zeit zu suchen, in der sich der Begriff "Osteuropa" in den europäischen Sprachen noch gar nicht herausgebildet hatte.
] zählt der Hinweis auf den "barbarischen" und "halb-asiatischen" Charakter Russlands und seiner Bewohner zu den hartnäckigen Klischees des westlichen Russland-Bildes.45 Aus diesem Grund erscheint es lohnend und plausibel, die Wurzeln unserer heutigen Vorstellung von "Osteuropa" in einer Zeit zu suchen, in der sich der Begriff "Osteuropa" in den europäischen Sprachen noch gar nicht herausgebildet hatte.
Einflussreich und weit verbreitet ist die Annahme, die Entstehung des heutigen westlichen Osteuropa-Bildes müsse auf das Zeitalter der Aufklärung datiert werden, das heißt ins späte 18. Jahrhundert.46 In dieser Zeit, so die Argumentation, hätten vor allem französische Philosophen, Reisende und Universalgelehrte die mental maps des Kontinents neu geordnet und die traditionelle Zweiteilung Europas in einen "Süden" und einen "Norden" durch das Bild eines in eine westliche und eine östliche Hälfte geteilten Kulturraums ersetzt. Die zentrale Kategorie der Zuordnung sei dabei nicht die geographische Lage eines Landes gewesen, sondern die Position einer Gesellschaft in der Zeitachse eines idealtypisch gedachten historischen "Fortschritts". Somit lautet die streitbare These, dass die im 20. Jahrhundert erfolgte Zweiteilung Europas entlang der Linie des Eisernen Vorhangs bereits im Diskurs der westlichen Aufklärung angelegt gewesen sei. Jene Länder, die später zum "Ostblock", das heißt zu dem politischen Raum "Eastern Europe" gezählt wurden, seien bereits im 18. Jahrhundert von den Philosophen als eine räumliche Entität wahrgenommen und beschrieben worden, die zahlreiche übereinstimmende Merkmale aufwies.47
bereits im Diskurs der westlichen Aufklärung angelegt gewesen sei. Jene Länder, die später zum "Ostblock", das heißt zu dem politischen Raum "Eastern Europe" gezählt wurden, seien bereits im 18. Jahrhundert von den Philosophen als eine räumliche Entität wahrgenommen und beschrieben worden, die zahlreiche übereinstimmende Merkmale aufwies.47
In der Reiseliteratur und Historiographie, in geographischen Beschreibungen und Selbstzeugnissen des "aufgeklärten" 18. Jahrhunderts sei "Osteuropa", dieser Theorie weiter folgend, als Kontrast- und Abgrenzungsfolie für einen imaginierten, fortschrittlichen "Westen" erfunden worden. Im Vergleich mit diesem idealtypischen Hort der "Zivilisation" hätten die westlichen Gelehrten "Osteuropa" als relativ unterentwickelt wahrgenommen und dargestellt. Anders als der "Orient", der sich aus westlicher Sicht als Raum "ewiger" Rückständigkeit präsentiert habe, zeichnete sich das östliche Europa aus der Sicht der Philosophen zumindest durch eine gewisse Entwicklungsdynamik aus. Osteuropa war aus westlicher Sicht ein klassischer Raum des Übergangs – von der "Barbarei" in die "Zivilisation", vom geschichtslosen "Orient" zum fortschrittlichen "Westen".48 Anzeichen "kultivierten" Lebens im östlichen Europa hätten westliche Beobachter jedoch als Oberflächenphänomene abgetan, denn das Projekt der "Zivilisierung" und "Aufklärung" der östlichen Hälfte des Kontinents hatte ihrer Meinung nach erst begonnen.
hätten westliche Beobachter jedoch als Oberflächenphänomene abgetan, denn das Projekt der "Zivilisierung" und "Aufklärung" der östlichen Hälfte des Kontinents hatte ihrer Meinung nach erst begonnen.
Somit wird der "Erfindung" Osteuropas durch Reisende und Gedankenreisende der Aufklärungszeit große Bedeutung beigemessen. Der westliche Diskurs über das östliche Europa wird ähnlich wie der von Edward Said (1935–2003) beschriebene "Orientalismus" als ein Diskurs der Überlegenheit und Dominanz verstanden, der das Feld für spätere militärische, politische und wirtschaftliche Eroberungs- und Kolonisierungspläne bereitet habe.49 Die gedankliche Kartierung Osteuropas durch westliche Aufklärer müsse gar als gedankliche Vorbereitung für die raum- und besitzergreifende Expansion des Westens ins östliche Europa interpretiert werden, die beispielsweise die Teilungen Polens , die Eroberung Russlands durch Napoleon Bonaparte (1769–1821) und die "Ostraumpolitik" NS-Deutschlands nach sich zogen.50 Kognitive Karten, so das abgeleitete Argument, zeichnen sich nicht nur durch eine lange Lebensdauer aus. Sie haben zudem eine wichtige handlungsleitende Funktion, die von der historischen Forschung sehr ernst genommen werden muss.
, die Eroberung Russlands durch Napoleon Bonaparte (1769–1821) und die "Ostraumpolitik" NS-Deutschlands nach sich zogen.50 Kognitive Karten, so das abgeleitete Argument, zeichnen sich nicht nur durch eine lange Lebensdauer aus. Sie haben zudem eine wichtige handlungsleitende Funktion, die von der historischen Forschung sehr ernst genommen werden muss.
Die "Erfindung" Osteuropas in der Diskussion
Diese pointierte These von der "Erfindung" Osteuropas im Zeitalter der Aufklärung ist in der Forschung nicht unumstritten. Kritik daran zielt unter anderem darauf ab, dass hierbei Länder und Regionen unter einem Osteuropa-Begriff subsumiert werden, der als solcher in den Quellen noch gar nicht auftaucht.51 Zudem wurde moniert, dass nur Berichte über Länder in die Analyse einbezogen wurden, die im 20. Jahrhundert als Teil "Osteuropas" galten. Daraus lässt sich der Vorwurf ableiten, hier würden Raumvorstellungen aus der Gegenwart ins 18. Jahrhundert zurückprojiziert.52 Vergleichsstudien zu den Polen- und Frankreich-Berichten deutscher Reisender aus dem späten 18. und frühen 19. Jahrhundert haben beispielsweise ergeben, dass sich Attribute des (angeblichen) westlichen "Osteuropa"-Diskurses wie das der relativen "Rückständigkeit" auch in zeitgenössischen Reise-Texten über die französische Provinz wiederfinden.53 Wiederholt wurde auch darauf hingewiesen, dass die "Erfindung" Osteuropas nicht allein als ein Projekt westlicher Fremdbeschreibungen zu betrachten sei und man die Rolle der Menschen in Osteuropa in diesem Prozess des mental mapping miteinbeziehen und ernst nehmen müsse.54 Eine andere Studie, die sich mit der Geschichte des französischen Osteuropa-Diskurses von der Mitte des 18. bis ins späte 19. Jahrhundert befasst hat, stellt die These von der "Erfindung" Osteuropas im Zeitalter der Aufklärung gänzlich in Frage und datiert die Durchsetzung der "discursive formation" eines "Euro-Orientalismus" erst in die 1870er Jahre.55
Ungeachtet dieser Kritik hat die Theorie von der "Erfindung" Osteuropas durch die Philosophen des 18. Jahrhunderts die historische Forschung zu kollektiven Raumvorstellungen in der neueren europäischen Geschichte besonders angeregt und vorangebracht56 und kann als eine der wichtigsten Pionierstudien zur Geschichte der kognitiven Karten Europas angesehen werden. Für zukünftige Forschungen erscheint es nun vielversprechend,
- genauer dem dialogischen Wechselverhältnis unterschiedlicher geschichtsräumlicher Konzepte wie "Osteuropa" und "der Westen", "Ostmitteleuropa", "Balkan" etc. nachzugehen,
- nach dem Beitrag verschiedener Wissenschaftsdisziplinen (Geographie, Geschichte, Anthropologie, Literaturwissenschaft etc.) zu den entsprechenden Raumdiskursen zu fragen und
- die Konstruktion entsprechender Raumvorstellungen als das Ergebnis eines "Dialogs" zwischen Diskursen der Fremd- und Selbstbeschreibung zu analysieren.57
Fazit
Das Konzept des mental mapping kann mittlerweile als etabliertes Paradigma einer historischen Forschungsrichtung angesehen werden, die sich für die Geschichte kollektiver Vorstellungen von der räumlichen Strukturierung der Welt und ihrer Teilregionen interessiert. Mit Hilfe des aus der Kognitionspsychologie und Geographie entlehnten Konzepts der kognitiven Landkarte lassen sich individuelle und kollektive Repräsentationen einer erfahrenen und imaginierten räumlichen Umwelt beschreiben und untersuchen. Historische Forschungsarbeiten zur Geschichte der kognitiven Kartierung Europas und seiner Teilräume können dabei an ältere Studien der Reise- und Stereotypenforschung sowie der Kartographie- und Wissenschaftsgeschichte anknüpfen.
Das Erkenntnispotential, das mit der raumbezogenen Metapher der mental map verbunden ist, erscheint dabei vielfach noch nicht gänzlich ausgeschöpft. Inwieweit kollektive Vorstellungen europäischer Großregionen tatsächlich Charakteristika einer "Landkarte" aufweisen, wäre beispielsweise durch eine verstärkte Berücksichtigung von historischem und geographischem Kartenmaterial in der historischen mental maps-Forschung zu untersuchen. Offen bleibt auch die Frage nach der handlungsleitenden Kraft kollektiv geteilter Raumbilder. Inwieweit sich beispielsweise Napoleon bei der Planung seines Russland-Feldzuges im Jahr 1812 tatsächlich vom entstehenden Osteuropa-Bild des Aufklärungszeitalters leiten ließ, müsste in konkreten Forschungen noch verifiziert werden. Vor allem für regionalwissenschaftlich arbeitende Wissenschaftsdisziplinen stellt die Einsicht in die historische Bedingtheit der selbstgewählten Raumkategorien zweifelsohne eine Herausforderung dar, die während des Forschungsprozesses permanent zu vergegenwärtigen ist.
Frithjof Benjamin Schenk
Anhang
Quellen
Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG (Hg.): Art. "Osteuropa", in: Brockhaus: Enzyklopädie in 30 Bänden 20 (2006), 21. Aufl., Leipzig u.a. 2006, S. 584f.
Central Intelligence Agency (Hg.): Central Asia, in: Central Intelligence Agency (Hg.): The World Factbook, Washington 2012.
Encyclopædia Britannica (Hg.): Britannica Online Encyclopedia, London u.a. 2012. URL: http://www.britannica.com/ [2021-03-22]
European Union (Hg.): External Actions, Brüssel 2012.
Prochorov, Aleksandr M. (Hg): Art. "Vostok", in: Bol'šaja Sovetskaja Ėnciklopedija 5 (1971), 3. Aufl., Moskau u.a. 1971.
Thunmann, Johann Erich: Untersuchungen über die Geschichte der östlichen europäischen Völker, Leipzig 1774.
United Nations Statistics Division (Hg.): Composition of Macro Geographical (Continental) Regions, Geographical Sub-Regions, and Selected Economic and Other Groupings, New York 2012. URL: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm#europe [2021-03-22]
Internetquelle
Mishkova, Diana / Trencsenyi, Balazs (Hg.): European Regions and Boundaries: A Conceptual History, hg. v. Centre for Advances Studies in Sofia. URL: https://regions.cas.bg/ [2024-02-22]
Literatur
Adamovsky, Ezequiel: Euro-Orientalism: Liberal Ideology and the Image of Russia in France (c. 1740–1880), Oxford u.a. 2006.
Adamovsky, Ezequiel: Euro-Orientalism and the Making of the Concept of Eastern Europe in France, 1810–1880, in: Journal of Modern History 77,3 (2005), S. 591–628. URL: https://www.jstor.org/stable/10.1086/497718 / URL: https://doi.org/10.1086/497718 [2021-03-22]
Arnason, Johann P.: Historians in Search of Borders: Mapping the European East, in: Themenportal Europäische Geschichte (2006). URL: http://www.europa.clio-online.de/2006/Article=165 [2021-03-22]
Bachmann-Medick, Doris: Cultural Turns: Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften, Reinbek 2006. URL: https://doi.org/10.1515/9783110402988 [2021-03-22]
Barth-Scalmani, Gunda / Scharr, Kurt: Mental Maps historischer Reiseführer: Zur touristischen Verdichtung von Kulturräumen in den Alpen am Beispiel der Brennerroute, in: Histoire des Alpes, Storia delle Alpi, Geschichte der Alpen 9 (2004), S. 203–224.
Bassin, Mark: Classical Eurasianism and the Geopolitics of Russian Identity. URL: https://cesran.org/classical-eurasianism-and-the-geopolitics-of-russian-identity.html [2021-03-22]
Bassin, Mark: Eurasianism "Classical" and "Neo": The Lines of Continuity, in: Slavic Eurasian Studies 17 (2008), S. 279–294. URL: https://src-h.slav.hokudai.ac.jp/coe21/publish/no17_ses/contents.html [2021-03-22]
Bernhardt, Petra: Einbildung und Wandel der Raumkategorie "Osten" seit 1989: Werbebilder als soziale Indikatoren, in: Image 10 (2009). URL: http://www.gib.uni-tuebingen.de/image/ausgaben-3 [2021-03-22]
Bethke, Carl: Von der gesellschaftlichen Verantwortung des Historikers: Das Südosteuropa der 1990er Jahre im Spiegel der Veröffentlichungen von Holm Sundhaussen, in: Ulf Brunnbauer u.a. (Hg.): Schnittstellen: Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa: Festschrift für Holm Sundhaussen zum 65. Geburtstag, München 2007, S. 15–24.
Bisaha, Nancy: Creating East and West: Renaissance Humanists and the Ottoman Turks, Philadelphia 2004. URL: https://doi.org/10.9783/9780812201291 [2021-03-22]
Brunnbauer, Ulf: "Europa" und der "Balkan": Fremd und Selbstzuschreibungen, Vorlesung am Osteuropa-Institut der Freien Universität, Berlin 2005.
Brunnbauer, Ulf: Europa und sein Balkan: Ein Essay über die Macht der Vorstellung, in: Uwe Hinrichs (Hg.): Handbuch der Eurolinguistik, Wiesbaden 2010 (Slavistische Studienbücher 20), S. 91–109.
Casey, Steven u.a. (Hg.): Mental Maps in the Early Cold War Era: 1945–68, Basingstoke u.a. 2011. URL: https://doi.org/10.1057/9780230306066 [2021-03-22]
Casey, Steven u.a. (Hg.): Mental Maps in the Era of the Two World Wars, Houndmills 2008. URL: https://doi.org/10.1057/9780230227606 [2021-03-22]
Cilauro, Santo: Molwanien: Land des schadhaften Lächelns, 5. Aufl., München 2005.
Confino, Michael: Re-Inventing the Enlightenment: Western Images of Eastern Realities in the Eighteenth Century, in: Canadian Slavonic Papers 36,3–4 (1994), S. 505–522. URL: https://www.jstor.org/stable/40869682 / URL: https://doi.org/10.1080/00085006.1994.11092071 [2021-03-22]
Conrad, Christoph (Hg.): Mental Maps, in: Geschichte und Gesellschaft 28,3 (2002), S. 339–514. URL: https://www.jstor.org/stable/i40005724 / URL: https://www.digizeitschriften.de/dms/toc/?PID=PPN483856525_0028 [2021-03-22]
Danilevskij, Nikolaj Jakovlevič: Russland und Europa: Eine Untersuchung über die kulturellen und politischen Beziehungen der slawischen zur germanisch-romanischen Welt, übersetzt und eingeleitet von Karl Nötzel, Osnabrück 1965.
Dipper, Christof u.a. (Hg): Kartenwelten: der Raum und seine Repräsentation in der Neuzeit, Darmstadt 2006.
Döring, Jörg u.a. (Hg.): Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld 2008. URL: https://doi.org/10.14361/9783839406830 [2021-03-22]
Downs, Roger M. / Stea, David: Kognitive Karten: Die Welt in unseren Köpfen, New York 1982 (Originalausgabe: Maps in Minds: Reflections on Cognitive Mapping, New York 1977).
Downs, Roger M. et al.: Raum als kognitives und sprachliches Problem, in: Harro Schweizer (Hg.): Sprache und Raum: psychologische und linguistische Aspekte der Aneignung und Verarbeitung von Räumlichkeit: ein Arbeitsbuch für das Lehren von Forschung, Stuttgart 1985, S. 17-64.
Drace-Francis, Alex: A Provincial Imperialist and a Curious Account of Walachia: Ignaz von Born, in: European History Quarterly 36,1 (2006), S. 61–89. URL: https://doi.org/10.1177/0265691406059612 [2021-03-22]
Drace-Francis, Alex: Towards a Natural History of East European Travel Writing, in: Wendy Bracewell u.a. (Hg.): Under Eastern Eyes: A Comparative Introduction to East European Travel Writing on Europe, Budapest 2008, S. 1–26. URL: https://www.jstor.org/stable/10.7829/j.ctv10tq5jm.4 [2021-03-15]
Dupcsik, Csaba: Postcolonial Studies and the Inventing of Eastern Europe, in: East Central Europe 26 (1999), S. 1–14. URL: https://doi.org/10.1163/187633099X00013 [2021-03-22]
Faraldo, José M. u.a. (Hg.): Europa im Ostblock: Vorstellungen und Diskurse (1945–1991), Köln 2008 (Zeithistorische Studien 44).
Gebhard, Gunther u.a. (Hg.): Das Prinzip "Osten": Geschichte und Gegenwart eines symbolischen Raums, Bielefeld 2010. URL: https://doi.org/10.14361/transcript.9783839415641 [2021-03-22]
Gotthard, Axel: Wohin führt uns der "Spatial turn"? Über mögliche Gründe, Chancen und Grenzen einer neuerdings diskutierten historiographischen Wende, in: Wolfgang Wüst u.a. (Hg.): Mikro – Meso – Makro: Regionenforschung im Aufbruch, Erlangen 2005, S. 15–49.
Gould, Peter / White, Rodney: Mental Maps, 2. Aufl., Boston 1992.
Götz, Norbert u.a. (Hg.): Die Ordnung des Raums: Mentale Landkarten in der Ostseeregion, Berlin 2006.
Happel, Jörn u.a. (Hg.): Osteuropa kartiert – Mapping Eastern Europe, Berlin u.a. 2010.
Hard, Gerhard: Der spatial turn von der Geographie her beobachtet, in: Jörg Döring u.a. (Hg.): Spatial turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften, Bielefeld 2008, S. 263–315. URL: https://doi.org/10.14361/9783839406830-011 [2021-03-22]
Hartmann, Angelika: Konzepte und Transformationen der Trias "Mental Maps, Raum und Erinnerung", in: Sabine Damir-Geilsdorf u.a. (Hg.): Mental Maps – Raum – Erinnerung: Kulturwissenschaftliche Zugänge zum Verhältnis von Raum und Erinnerung, Münster 2005 (Kulturwissenschaft: Forschung und Wissenschaft 1), S. 3–21.
Hösch, Edgar: Samuel Huntington und die orthodoxe Welt, in: Ulf Brunnbauer (Hg.): Schnittstellen: Gesellschaft, Nation, Konflikt und Erinnerung in Südosteuropa: Festschrift für Holm Sundhaussen zum 65. Geburtstag, München 2007, S. 381–400.
Jezernik, Božidar: Wild Europe: The Balkans in the Gaze of Western Travellers, London 2004.
Johnston, R. J.: Mental Maps of the City: Suburban Preference Patterns, in: Environment and Planning 3 (1971), S. 63–72. URL: https://doi.org/10.1068/a030063 [2021-03-22]
Jordan, Peter: Großgliederung Europas nach kulturräumlichen Kriterien, in: Europa Regional 13,4 (2005), S. 162–173. URL: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-48072-8 [2021-03-22]
Jureit, Ulrike: Das Ordnen von Räumen: Territorium und Lebensraum im 19. und 20. Jahrhundert, Hamburg 2012.
Kamusella, Tomasz: School Historical Atlases as Instruments of Nation-State Making and Maintenance: A Remark on the Invisibility of Ideology in Popular Education, in: Journal of Educational Media, Memory, and Society 2 (2010). URL: https://www.jstor.org/stable/43049343 [2021-03-22]
Kappeler, Andreas: Osteuropäische Geschichte, in: Michael Maurer (Hg.): Aufriß der Historischen Wissenschaften, vol. 2: Räume, Stuttgart 2001, S. 198–265.
Kaser, Karl u.a. (Hg.): Europa und die Grenzen im Kopf, Klagenfurt 2003 (Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 11).
Koller, Christophe u.a. (Hg.): Karten, Kartographie und Geschichte: Von der Visualisierung der Macht zur Macht der Visualisierung, Zürich 2010.
Kitchin, Robert M.: Cognitive Maps: What Are They and Why Study Them?, in: Journal of Environmental Psychology 14 (1994), S. 1–19. URL: https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80194-X [2021-03-22]
Kitchin, Robert M. / Blades, Mark: The Cognition of Geographic Space, London 2001.
Kivelson, Valerie A.: Cartographies of Tsardom: The Land and its Meanings in Seventeenth-Century Russia, Ithaca 2006.
Klug, Ekkehard: Das "asiatische" Russland: Über die Entstehung eines europäischen Vorurteils, in: Historische Zeitschrift 245 (1987), S. 265–289. URL: https://doi.org/10.1524/hzhz.1987.245.jg.265 / URL: https://www.jstor.org/stable/27625824 [2021-03-22]
Langenohl, Andreas: Mental maps, Raum und Erinnerung: Zur kultursoziologischen Erschließung eines transdisziplinären Konzepts, in: Sabine Damir-Geilsdorf u.a. (Hg.): Mental Maps, Münster 2005 (Kulturwissenschaft: Forschung und Wissenschaft 1) S. 51–69.
Lemberg, Hans: Zur Entstehung des Osteuropabegriffs im 19. Jahrhundert: Vom "Norden" zum "Osten" Europas, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 33,1 (1985), S. 48–91. URL: https://www.jstor.org/stable/41046924 / URL: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00003833/image_56 [2021-03-22]
Lewis, Martin W. / Wigen, Kären E.: The Myth of Continents: A Critique of Metageography, Berkeley 1997. URL: https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnv6t [2021-03-22]
Liulevicius, Vejas Gabriel: The German Myth of the East: 1800 to the Present, Oxford 2009. URL: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199546312.001.0001 [2021-03-22]
Lorenz, Dagmar (Hg.): Konzept Osteuropa: Der "Osten" als Konstrukt der Fremd- und Eigenbestimmung in deutschsprachigen Texten des 19. und 20. Jahrhunderts, Würzburg 2011.
Lotz, Christian: Die anspruchsvollen Karten: Polnische, ost- und westdeutsche Auslandsrepräsentationen und der Streit um die Oder-Neiße-Grenze (1945–1972), Magdeburg 2011 (Studien des Leipziger Kreises 10).
Lynch, Kevin A.: The Image of the City, Cambridge 1960.
Martin, Thomas (Hg.): The French Colonial Mind, Lincoln 2011 (France Overseas: Studies in Empire and Decolonization), vol. 1: Mental Maps of Empire and Colonial Encounters.
Maxwell, Alexander: Introduction: Bridges and Bulwarks: A Historiographic Overview of East-West Discourses, in: Maxwell, Alexander (Hg.): The East-West Discourse: Symbolic Geography and its Consequences, Oxford 2011 (Nationalisms Across the Globe 8), S. 1–32.
Mervaud, Michel / Roberti, Jean-Claude: Une infinie brutalité: L'image de la Russie dans la France des XVIe et XVIIe siècles, Paris 1991 (Cultures et sociétés de l'Est 15).
Müller, Dietmar: Southeastern Europe as Historical Macro-Region, in: European Review of History 10,2 (2003), S. 393–408. URL: https://doi.org/10.1080/1350748032000140868 [2021-03-22]
Neumann, Iver B.: Russia and the Idea of Europe: A Study in Identity and International Relations, London 1996 (The New International Relations). URL: https://doi.org/10.4324/9781315646336 [2021-03-18]
Neumann, Iver B.: Uses of the Other: "The East" in European Identity Formation, Manchester 1999 (Borderlines 9). URL: https://www.jstor.org/stable/10.5749/j.ctttv1zn [2021-03-22]
Orlinski, Wojciech: Ex oriente horror: Osteuropa-Stereotypen in der Populärkultur, in: Transit: Europäische Revue 31 (2006), S. 132–152. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=884006 [2021-03-22]
Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt: Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, München 2009 (Historische Bibliothek der Gerda Henkel Stiftung).
Poe, Marshal T.: "A People Born to Slavery": Russia in Early Modern European Ethnographs: 1476–1748, Ithaca 2000 (Studies of the Harriman Institute).
Petronis, Vytautas: Constructing Lithuania: Ethnic Mapping in Tsarist Russia, ca. 1800–1914, Stockholm 2007 (Stockholm Studies in History 91).
Portugali, Juval: Introduction, in: Juval Portugali: The Construction of Cognitive Maps, Dordrecht 1996 (The GeoJournal Library 32), S. 1–7. URL: https://doi.org/10.1007/978-0-585-33485-1_1 [2021-03-22]
Said, Edward: Orientalism, New York 1979.
Schelting, Alexander von: Russland und Europa im russischen Geschichtsdenken: Auf der Suche nach der historischen Identität, hg. und mit einem Nachwort von Christiane Uhlig, Bietigheim-Bissingen 1997.
Schenk, Frithjof Benjamin: The Historical Regions of Europe: Real or Invented? Some Remarks on Historical Comparison and Mental Mapping, in: Frithjof Benjamin Schenk (Hg.): Beyond the Nation: Writing European History Today, St. Petersburg 2004 (Working Papers des Zentrums für Deutschland und Europastudien 1).
Schenk, Frithjof Benjamin: Mental Maps: Die Konstruktion von geographischen Räumen in Europa seit der Aufklärung: Literaturbericht, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 493–514. URL: https://www.jstor.org/stable/40186205 / URL: http://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PID=PPN483856525_0028|log32 [2021-03-22]
Schlögel, Karl: Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik, München 2003.
Schraut, Sylvia: Kartierte Nationalgeschichte: Geschichtsatlanten im internationalen Vergleich: 1860–1960, Frankfurt 2011.
Schulze Wessel, Martin: Art. "Westen; Okzident", in: Historisches Wörterbuch der Philosophie 12 (2004), Sp. 667–672.
Stråth, Bo: Karten - Repräsentationen Europas aus vier Jahrhunderten, in: Themenportal Europäische Geschichte (2007). URL: http://www.europa.clio-online.de/2007/Article=151 [2021-03-22]
Struck, Bernhard: Vom historisch-klimatischen Raum zum politischen Raum: Europas mentale Geografien um 1800, in: Themenportal Europäische Geschichte (2007). URL: http://www.europa.clio-online.de/2007/Article=186 [2021-03-22]
Struck, Bernhard: Nicht West, nicht Ost: Frankreich und Polen in der Wahrnehmung deutscher Reisender zwischen 1750 und 1850, Göttingen 2006.
Sundhaussen, Holm: Der Balkan: Ein Plädoyer für Differenz, in: Geschichte und Gesellschaft 29 (2003), S. 642–658. URL: https://www.jstor.org/stable/40186187 / URL: http://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PID=PPN483856525_0029|log35 [2021-03-22]
Sundhaussen, Holm: Europa balcanica: Der Balkan als historischer Raum Europas, in: Geschichte und Gesellschaft 25 (1999), S. 626–653. URL: https://www.jstor.org/stable/40185964 / URL: http://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PID=PPN483856525_0025|log53 [2021-03-22]
Sundhaussen, Holm / Schmitt, Jens Oliver: Die Wiederentdeckung des Raumes: Über Nutzen und Nachteil von Geschichtsregionen, in: Konrad Clewing u.a. (Hg.): Südosteuropa: Von moderner Vielfalt und nationalstaatlicher Vereinheitlichung: Festschrift Edgar Hösch, München 2005, S. 13–33.
Thum, Gregor: "Europa" im Ostblock: Weiße Flecken in der Geschichte der europäischen Integration, in: Zeithistorische Forschungen 1,3 (2003), S. 379–395. URL: https://doi.org/10.14765/zzf.dok-2046 [2021-03-22]
Thum, Gregor (Hg.): Traumland Osten: Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert, Göttingen 2006. URL: http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00065900-1 [2021-03-22]
Todorova, Maria: Spacing Europe: What is a Historical Region?, in: East Central Europe – L'Europe du Centre-Est: Eine wissenschaftliche Zeitschrift 32,1–2 (2005), S. 59–78. URL: https://doi.org/10.1163/18763308-90001032 / URL: https://doi.org/10.1163/18763308-90001032 [2021-03-22]
Todorova, Maria: Historische Vermächtnisse als Analysekategorie: Der Fall Südosteuropa, in: Karl Kaser u.a. (Hg.): Europa und die Grenzen im Kopf, Klagenfurt 2003 (Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 11), S. 227–252.
Todorova, Maria: Der Balkan als Analysekategorie: Grenzen, Raum, Zeit, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 470–492.
Todorova, Maria: Die Erfindung des Balkans: Europas bequemes Vorurteil, Darmstadt 1998.
Tolman, Edward C.: Cognitive Maps in Rats and Men, in: Psychological Review 55 (1948), S. 189–208. URL: http://psychclassics.yorku.ca/Tolman/Maps/maps.htm [2021-03-22]
Torma, Franziska: Turkestan Expeditionen: Zur Kulturgeschichte deutscher Forschungsreisen nach Mittelasien (1890–1930), Bielefeld 2011 (1800–2000: Kulturgeschichten der Moderne 5), S. 45–51. URL: https://doi.org/10.14361/transcript.9783839414491 [2021-03-22]
Troebst, Stefan: "Geschichtsregion": Historisch-mesoregionale Konzeptionen in den Kulturwissenschaften, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2010. URL: https://www.ieg-ego.eu/schenkf-2013-de URN: urn:nbn:de:0159-20100921364 [2021-03-22]
Tschižewskij, Dmitrij u.a. (Hg.): Europa und Russland: Texte zum Problem des westeuropäischen und russischen Selbstverständnisses, Darmstadt 1959.
Wagner, Kirsten: Kognitiver Raum: Orientierung – Mental Maps – Datenverwaltung, in: Stephan Günzel (Hg.): Raum: Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart 2010, S. 234–249. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-476-05326-8 [2021-03-22]
Wendland, Anna Veronika: Wie wir die Karten lesen: Osteuropäische Fragen an eine Europäische Geschichte und Europäische Einigung: Zwei Essays, München 2007 (Forost Arbeitspapier 41). URL: http://www.forost.lmu.de/index2.html [2021-03-22]
Wergin, Ulrich u.a. (Hg.): Bilder des Ostens in der deutschen Literatur, Würzburg 2009.
Werner, Michael / Zimmermann, Bénédicte: Vergleich, Transfer, Verflechtung: Der Ansatz der Histoire croisée und die Herausforderung des Transnationalen, in: Geschichte und Gesellschaft 28 (2002), S. 607–636. URL: https://www.jstor.org/stable/40185909 / URL: http://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PID=PPN483856525_0028|log38 [2021-03-22]
Wiederkehr, Stefan: Die eurasische Bewegung: Wissenschaft und Politik in der russischen Emigration der Zwischenkriegszeit und im postsowjetischen Russland, Köln 2007.
Wingfield, Nancy (Hg.): Creating the Other: Ethnic Conflict and Nationalism in Habsburg Central Europe, West Lafayette 2003. URL: https://doi.org/10.2307/j.ctt1x76dp7 [2021-03-22]
Wippermann, Wolfgang: Die Deutschen und der Osten: Feindbild und Traumland, Darmstadt 2007.
Wolff, Larry: Die Erfindung Osteuropas: Von Voltaire zu Voldemort, in: Karl Kaser u.a. (Hg.): Europa und die Grenzen im Kopf, Klagenfurt 2003 (Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens 11), S. 21–34.
Wolff, Larry: Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford 1994. URL: https://hdl.handle.net/2027/heb.05073 [2021-03-22]
Zernack, Klaus: Osteuropa: Eine Einführung in seine Geschichte, München 1977. URL: http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00107867-4 [2021-03-22]
Anmerkungen
- ^ Zum spatial turn in den Geschichts- und Kulturwissenschaften vgl. u.a. Schlögel, Im Raume 2003, insbes. S. 60–71; Gotthard, Spatial Turn 2005, S. 15–49; Döring, Spatial Turn 2008.
- ^ Tolman, Cognitive Maps 1948. Zu den historischen Wurzeln der interdisziplinären Orientierungs-Forschung vgl. Wagner, Kognitiver Raum 2010, S. 234–249.
- ^ Neben Edward C. Tolman gilt der Architekt und Stadtplaner Kevin A. Lynch (1918–1984) als spiritus rector der interdisziplinären Mental-Maps-Forschung. Vgl. Lynch, The Image 1960. Die geographische Mental-Maps-Forschung verfolgt nicht zuletzt das Ziel, mittels einer Analyse kognitiver Landkarten zum besseren Verständnis von "raumbezogene[m] Verhalten und Handeln" beizutragen. Vgl. dazu kritisch Hard, Der Spatial Turn 2008, S. 288.
- ^ Downs / Stea, Kognitive Karten 1982, S. 23.
- ^ Vgl. auch eine etwas anders akzentuierte Definition bei Portugali, Introduction 1996, S. 1.
- ^ Downs / Stea, Kognitive Karten 1982, S. 24.
- ^ Johnston, Mental Maps 1971, S. 63–72; Gould / White, Mental Maps 1992. In der geographischen Forschung der 1970er Jahre wurde der Begriff Mental Maps häufig als kognitive Entsprechung (vermeintlich exakter) "realer" Landkarten verwandt und mentale Repräsentationen nach Abweichungen von der "wirklichen" räumlichen Umgebung befragt. Kritisch dazu: Hartmann, Konzepte 2005, S. 8.
- ^ Bereits Downs und Stea wiesen darauf hin, dass sie den Begriff der "Karte" benutzen, um eine "funktionale Analogie" zu bezeichnen: "Wir richten unsere Aufmerksamkeit in erster Linie auf die kognitive Repräsentation, die zwar die Funktion der üblichen geographischen Karte teilt, aber nicht notwendigerweise die gegenständlichen Merkmale einer solchen zeichnerischen Darstellung aufweist." Downs / Stea, Raum 1985, S. 22.
- ^ Vgl. Lynch, The Image 1960.
- ^ Kitchin / Blades, The Cognition 2001, S. 1f.
- ^ Vgl. u.a. Conrad, Mental Maps 2002; Barth-Scalmani / Scharr, Mental Maps 2004, S. 203–224; Götz, Die Ordnung 2006; Casey, Two World Wars 2008; Osterhammel, Die Verwandlung 2009, S. 143–154; Torma, Turkestan Expeditionen 2011, S. 45–51; Brunnbauer, "Europa" 2005, S. 1f.; Martin, The French Colonial Mind 2011, vol. 1; Casey, Early Cold War Era 2011.
- ^ Vgl. Wagner, Kognitiver Raum 2010, S. 245.
- ^ Kitchin, Cognitive Maps 1994, S. 2.
- ^ Vgl. dazu zusammenfassend: Schenk, Mental Maps 2002, S. 493–514.
- ^ Wagner, Kognitiver Raum 2010, S. 245.
- ^ Wagner, Kognitiver Raum 2010, S. 247.
- ^ Vgl. z. B. Wolff, Inventing Eastern Europe 1994; Todorova, Erfindung des Balkans 1998.
- ^ Langenohl, Mental Maps 2005, S. 67.
- ^ Langenohl, Mental Maps 2005, S. 59f.
- ^ Vgl. exemplarisch: Dipper, Kartenwelten 2006; Kivelson, Cartographies 2006; Petronis, Constructing Lithuania 2007; Happel, Osteuropa 2010; Kamusella, School Historical Atlases 2010, S. 113–138; Koller, Karten 2010; Lotz, Die anspruchsvollen Karten 2011; Schraut, Kartierte Nationalgeschichte 2011.
- ^ Schenk, The Historical Regions 2004, S. 15–24. Zum Konzept der "Geschichtsregion" vgl. insbesondere Troebst, "Geschichtsregion" 2010.
- ^ Vgl. Todorova, Erfindung des Balkans 1998. Todorovas Kritik richtete sich unter anderem auf die Ausgrenzung und Stigmatisierung Südosteuropas durch Historiker wie Jenö Szücs (1928–1988) oder Peter Hanák (1921–1997).
- ^ Sundhaussen, Europa balcanica 1999, S. 626–653; Sundhaussen, Der Balkan 2003, S. 642–658. Zur "Todorova-Sundhaussen-Debatte" vgl. auch Müller, Southeastern Europe 2003, S. 393–408; Bethke, Von der gesellschaftlichen Verantwortung 2007, S. 21.
- ^ Die normativen Vorannahmen eines jeden historischen Vergleichs versucht der Ansatz der histoire croisée zu reflektieren und abzuschwächen. Vgl. dazu insbesondere Werner / Zimmermann, Vergleich 2002, S. 607–636.
- ^ Sundhaussen / Schmitt, Die Wiederentdeckung des Raumes 2005, S. 13–33; Todorova, Der Balkan 2002, S. 470–492; Todorova, Historische Vermächtnisse 2003, S. 227–252; Todorova, Spacing Europe 2005, S. 59–78; Troebst, "Geschichtsregion" 2010.
- ^ Ergänzend zu den in meinem Literaturbericht aus dem Jahr 2002 genannten Titeln (vgl. Schenk, Mental Maps 2002) sei exemplarisch auf einige neuere Arbeiten zur Konstruktion des "Ostens" bzw. "Osteuropas" hingewiesen: Neumann, Uses of the Other 1999; Adamovsky, Euro-Orientalism 2006; Arnason, Historians 2006; Thum, Traumland Osten 2006; Wippermann, Die Deutschen 2007; Wendland, Wie wir die Karten lesen 2007; Hösch, Samuel Huntington 2007; Bernhardt, Einbildung 2009; Wergin, Bilder des Ostens 2009; Liulevicius: The German Myth 2009; Gebhard, Das Prinzip "Osten" 2010; Happel, Osteuropa 2010; Lorenz, Konzept Osteuropa 2011.
- ^ Vgl. Art. "Osteuropa", Brockhaus 2006, S. 584f.; und Britannica Online Encyclopedia 2012.
- ^ Art. "Osteuropa", Brockhaus 2006, S. 584f. (Hervorhebung F.B.S.). In der Empfehlung des Ständigen Ausschusses für geographische Namen werden die drei baltischen Republiken dagegen Ostmitteleuropa zugerechnet: Vgl. Jordan, Großgliederung Europas 2005, S. 162–173.
- ^ Vgl. United Nations Statistics Division, Composition of Macro Geographical (Continental) Regions 2012.
- ^ Vgl. Central Intelligence Agency, Central Asia 2012.
- ^ Vgl. European Union, External Action 2012.
- ^ Zernack, Osteuropa 1977; Kappeler, Osteuropäische Geschichte 2001, S. 198–265.
- ^ Art. "Osteuropa", Brockhaus 2006, S. 584f.
- ^ Vgl. Maxwell, Introduction 2011, S. 1–32.
- ^ Neumann, Russia 1996; Abschnitt "Russland" in Schulze Wessel, Art. "Westen; Okzident" 2004, Sp. 667–672.
- ^ Vgl. z.B. Prochorov, Art. "Vostok" 1971, S. 388f. Daneben finden sich in russischen / sowjetischen Enzyklopädien Einträge über "Vostokovedenie" (Orientkunde), "Vostočnaja vojna" (Krimkrieg, wörtlich: Östlicher Krieg), "Vostočnyj vopros" (Orientalische Frage), "Vostočno-Evropejskaja platforma" (die Osteuropäische [tektonische] Tafel), aber kein Eintrag zu "Vostočnaja Evropa" ("Osteuropa").
- ^ Vgl. dazu Schelting, Russland und Europa 1997; Tschižewskij / Groh, Europa und Russland 1959; Danilevskij, Russland und Europa 1965.
- ^ Zur Dynamik der Europa-Diskurse im "Ostblock" während des Kalten Kriegs vgl. u.a. Thum, "Europa" 2003, S. 379–395; Faraldo, Europa im Ostblock 2008; zur Gedankenwelt der Eurasier: Wiederkehr, Eurasische Bewegung 2007; Bassin, Classical Eurasianism; Bassin, Eurasianism "Classical" and "Neo" 2008.
- ^ Vgl. Orlinski, Ex oriente horror 2006, S. 132–152. Eine humoristische Auseinandersetzung mit Osteuropa-Stereotypen bietet der fiktive Reiseführer Cilauro, Molwanien 2005.
- ^ Zum Folgenden vgl. insbesondere Lemberg, Zur Entstehung des Osteuropabegriffs 1985, S. 48–91.
- ^ Vgl. Lemberg, Zur Entstehung des Osteuropabegriffs 1985, passim. Als Buchtitel wurde der Begriff "Osteuropa" offenbar erstmals vom schwedischen Linguisten Johann Erich Thunmann (1746–1778) verwendet. Vgl. Thunmann, Untersuchungen 1774.
- ^ Lemberg, Zur Entstehung des Osteuropabegriffs 1985, S. 90.
- ^ Lemberg, Zur Entstehung des Osteuropabegriffs 1985, S. 62ff.
- ^ Lemberg, Zur Entstehung des Osteuropabegriffs 1985, S. 80–82.
- ^ Vgl. exemplarisch: Klug, Das "asiatische" Russland 1987, S. 265–289; Mervaud / Roberti, Une infinie brutalité 1991; Poe, "A People Born to Slavery" 2000.
- ^ Diese Datierung nimmt Larry Wolff in seiner Studie vor: Wolff, Inventing Eastern Europe 1994. Vgl. auch eine Zusammenfassung seiner Argumentation in: Wolff, Die Erfindung Osteuropas 2003, S. 21–34.
- ^ Vgl. Wolff, Inventing Eastern Europe 1994.
- ^ Kritisch zu Wolffs Adaption von Said, Orientalism 1979: Adamovsky, Euro-Orientalism 2005, S. 592ff.
- ^ Wolff, Inventing Eastern Europe 1994, S. 165.
- ^ Vgl. Liulevicius, German Myth 2009; Jureit, Ordnen von Räumen 2012.
- ^ Vgl. Adamovsky, Euro-Orientalism 2005, S. 592–594; Lewis / Wigen, The Myth of Continents 1997, S. 229; sowie die Zusammenfassung der frühen Diskussion bei: Schenk, Mental Maps 2002, S. 500f., und Drace-Francis, A Provincial Imperialist 2006, hier S. 61.
- ^ Kritisch zur Kontinuitätsthese des westlichen Osteuropa-Bildes von Voltaire bis hin zu Churchill: Confino, Re-Inventing the Enlightenment 1994, S. 522.
- ^ Struck, Nicht West 2006.
- ^ Dupcsik, Postcolonial Studies 1999, S. 1–14; Drace-Francis, Towards a Natural History 2008, S. 5.
- ^ Adamovsky, Euro-Orientalism 2005, S. 608. Vgl. auch Adamovsky, Euro-Orientalism 2006.
- ^ Alex Drace-Francis sieht folgende Arbeiten von Wolffs Inventing Eastern Europe beeinflusst: Jezernik, Wild Europe 2004; Bisaha, Creating East 2004; Wingfield, Creating the Other 2003. Vgl. Drace-Francis, A Provincial Imperialist 2006, S. 82, Fußnote 2.
- ^ Ein vergleichbarer Fragenkatalog liegt dem interdisziplinären Forschungsprojekt "European Regions and Boundaries: A Conceptual History" zugrunde, das vom Centre for Advances Studies in Sofia sowie von Diana Mishkova (*1958) und Balázs Trencsény (*1973) in Budapest koordiniert wird.

![Johann Reinhold (1729–1798) und Georg Forster (1754–1794) in Tahiti John Francis Rigaud (1742–1810), Johann Reinhold und Georg Forster in Tahiti, o. J. [zwischen 1775–1780]; Bildquelle: Privatbesitz [wikimedia commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forsterundsohn.jpg?uselang=de.]](./illustrationen/anglophilie-bilderordner/johann-reinhold-172920131798-und-georg-forster-175420131794-in-tahiti/@@images/image/thumb)