Einleitung
In der Geschichte des Bodens überlappen sich unterschiedliche Dimensionen, die per se unabhängig voneinander sind. Boden war gleichzeitig Hoheitsgebiet, Grundlage agrarischer Produktion, Reservoir von Bodenschätzen, Betretungs- und Verkehrsobjekt, Gegenstand von Expertenwissen und Wissenschaft sowie Eigentum von Staat oder Privatpersonen. Die jeweils spezifischen Logiken, die sich mit diesen Dimensionen des Bodens verbanden, sorgten für zahlreiche Konflikte, die umso schwieriger zu lösen waren, als sich in den meisten Feldern seit dem 19. Jahrhundert eine wachsende Dynamik entwickelte. Wenn man die moderne Geschichte in diesem Sinne "von unten" sieht, ist sie auch die Geschichte einer Mobilisierung des Bodens.
In einem historischen Projekt, das Europa als das Produkt interkultureller Transferprozesse betrachten will, scheint ein Beitrag über den Boden auf den ersten Blick auf ein gewisses Missverständnis hinzudeuten. Boden ist kein typisches Transferprodukt, sondern vielmehr in hohem Maße immobil. Als physisches Substrat ist der Boden das Produkt langfristiger geologischer Prozesse, und so erstreckt sich eine Geschichte des Bodens im naturwissenschaftlichen Sinne über Zeiträume, gegen die sich die Geschichte der Menschheit wie ein Wimpernschlag ausnimmt. In mehr als einem europäischen Land wurde der Boden deshalb zum nachgerade klassischen Symbol für Beständigkeit und Traditionalismus. Und wenn Wind oder Wasser den Boden dann doch einmal in Bewegung bringen, richtet er sich unter völliger Missachtung kultureller Befindlichkeiten nach den Naturgesetzen.
Eine Geschichte des Bodens ist mithin als historisches Projekt nur legitimierbar, wenn man die Beziehung von Mensch und Natur (➔ Medien Link #ab) ins Zentrum stellt. Es geht also weniger um den Boden als solchen als vielmehr um den "Boden unter unseren Füßen", und die Doppeldeutigkeit dieser Formulierung lässt schon erkennen, dass eine solche Betrachtung einen quasi subversiven Zugang zur Geschichte Europas eröffnet. Man kann die neuere und neueste Geschichte Europas nämlich auch als eine Geschichte der Mobilisierung des Bodens schreiben, der in mehrfacher Beziehung in Bewegung kam: als Eigentum, als Betretungsobjekt, als Lagerstätte von Bodenschätzen, als staatliches Territorium. Es ist ein multidimensionaler Wandlungsprozess, der Mensch und Boden seit dem ausgehenden Mittelalter miteinander verband und miteinander veränderte, und diese unterschiedlichen Dimensionen scheinen häufig nur sehr locker miteinander verknüpft – wenn überhaupt. Die Geschichte des Bodens in der Moderne lässt sich somit auch als ein Experiment mit ungewissem Ausgang betrachten: Was passiert, wenn sich unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Interessen und Sichtweisen über eine Ressource hermachen, die prinzipiell begrenzt ist?
Die folgende Skizze versteht sich als Problemaufriss zu einer Ressource, deren Besonderheit auch von umweltbewegten Individuen häufig verkannt wird. Der Boden ist ein vergleichsweise träges Umweltmedium, das einerseits selbst krasse Formen des Missbrauchs mit einem gewissen Langmut erträgt, andererseits aber auch die Folgen mit einer gewissen Sturheit lange sichtbar erhält; ein zerstörter Boden ist weitaus schwieriger zu reparieren als beispielsweise ein verseuchtes Gewässer. Insofern könnte man die Geschichte des Bodens in der Moderne auch als spannungsreichen Wettstreit zwischen dem menschlichen und dem ökologischen Gedächtnis beschreiben, jedenfalls wenn man eine gewisse Nachsicht gegenüber Anthropomorphismen walten lässt. An sich liefert der Boden – wie alle Naturobjekte – keine normativen Vorgaben zu gutem und schlechtem Verhalten und pflegt stattdessen eine Eigenlogik, deren Decodierung bis heute unvollständig ist.
Boden und Macht
Es bedeutet keinen Rückfall in tradierte Kategorien der Politikgeschichte, wenn man die Frage nach nationalstaatlichen Territorien an den Anfang einer solchen Betrachtung stellt. Konflikte um Grenzen ziehen sich durch die Geschichte Europas, und doch macht man eine interessante Beobachtung, wenn man diese Auseinandersetzungen einmal "von unten", als Teil einer Geschichte des Bodens betrachtet. Die Immobilität des Bodens könnte zu der Annahme verleiten, dass er sich für geographisch präzise Markierungen eignete, jedenfalls dort, wo es keine in Bewegung befindliche Frontier gab. Tatsächlich waren Vorstellungen territorialer Grenzen (➔ Medien Link #ac) jedoch lange weitaus unschärfer, als es die Linien in unseren Geschichtsatlanten suggerieren.
Besonders eindrücklich lässt sich dies am Beispiel der Grenze Frankreichs und Spaniens in den Pyrenäen (➔ Medien Link #ad) demonstrieren, die als Teil der Entstehungsgeschichte der jeweiligen Nation untersucht werden kann. Es handelt sich um eine der stabilsten politischen Grenzen Europas, die seit der Annexion der Provinz Roussillon durch Frankreich 1659/1660 (➔ Medien Link #ae) keine wesentlichen Veränderungen erfahren hat. Umso bemerkenswerter ist deshalb, dass diese Grenze erst 1868 geographisch präzise festgelegt und durch Grenzsteine markiert wurde.1
Interessant ist auch, dass diese Grenze nicht den natürlichen Gegebenheiten folgte. Die Pyrenäengrenze orientierte sich hier nicht an Berggipfeln, sondern durchschnitt ein Flusstal und entlarvt mithin den französischen Mythos der "limites naturelles". Diese "natürlichen" Grenzen wurden politisch erst in der Zeit der Französischen Revolution virulent, als sich die europäischen Grenzen im Zuge der Revolutionskriege (➔ Medien Link #af) verflüssigten; entscheidend waren dabei vor allem militärisch günstige Positionen. Die Reunionspolitik Ludwigs XIV. von Frankreich (1638–1715) (➔ Medien Link #ag) hatte sich um eine Doktrin natürlicher Grenzen nicht geschert und stattdessen alte Rechtstitel mobilisiert. Das Naturrecht der Aufklärung hatte zwar eine Begründung der Notwendigkeit klarer Grenzziehungen geliefert, aber keinen Weg geboten, diese in der Landschaft zu lokalisieren.2
Mit einem Bewusstsein für geographische Lebensräume hatte das Konzept der natürlichen Grenzen jedenfalls wenig zu tun. Nur dort, wo Bergketten politische Grenzen markierten, waren militärische und naturräumliche Logiken einigermaßen kongruent. Die Rheingrenze hätte man aus ökologischer Sicht hingegen gerade nicht in der Flussmitte, sondern an den Wasserscheiden markieren müssen. Es ist fürwahr bemerkenswert, wie lange sich politisch dekretierte Grenzen gegen ökologische Logiken zu behaupten vermochten. Im deutschen Wasserrecht war es zum Beispiel erst die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union von 2000, die dazu verpflichtete, bei der Reinhaltung der Gewässer auf das gesamte Einzugsgebiet eines Flusses zu achten und nicht nur auf jenen Abschnitt, der zufällig in bestimmte politische Zuständigkeitsgebiete fiel - in manchen Landratsämtern ein regelrechter Kulturschock.
Im Hintergrund dieser Präzisierung von Grenzen stand die Entwicklung von Geodäsie und Kartographie, die eine geographisch exakte Definition erst möglich machte. Besonders gut ist dieser Nexus für die Topographische Karte der Schweiz dokumentiert, die von 1833 bis 1865 unter der Leitung des Generals Guillaume-Henri Dufour (1787–1875) (➔ Medien Link #ah) produziert wurde – ein wichtiger Akt helvetischen nation-buildings, in dem militärisch-politische Akteure mit wissenschaftlich geschulten Experten zusammenkamen. Dass der schweizerische Bundesrat noch zu Lebzeiten des Generals beschloss, dem höchsten Alpengipfel des Landes den Namen "Düfourspitze" (➔ Medien Link #ai) zu verleihen, spiegelte die Symbiose der Einzelinteressen besonders nachdrücklich wider.3
Boden als Besitzobjekt
"Die Ordnung des Bodens ist eine Grundoperation der Moderne […]. Es gilt die Regel: Kein Staat ist 'modern' ohne Kataster und ohne rechtlich frei disponibles Grundeigentum."4 Eine solche Aussage könnte auf griechische Leser befremdend wirken, denn in Griechenland wurde ein landesweites Grundbuch erst vor wenigen Jahren in Angriff genommen. Als allgemeine Beobachtung trifft die Bemerkung jedoch einen zentralen Aspekt der Mobilisierung des Bodens im 19. und 20. Jahrhundert. Die Grundidee des Bodenrechts in der Moderne besteht in der Ablösung eines komplizierten, letztlich nur historisch verständlichen Geflechts von Rechtstiteln durch ein bürgerliches Eigentumsrecht mit schriftlich fixierten Verfahrenswegen für Vermietung, hypothekarische Beleihung und Verkauf. In der Moderne ist Boden prinzipiell am Markt handelbar. In vormodernen Gesellschaften war die Möglichkeit eines Besitztransfers hingegen ganz von den spezifischen Bedingungen des jeweiligen Ortes abhängig.
Diese juristische Flurbereinigung ging einher mit einer Vereinfachung der Nutzungsstrukturen. Zur vormodernen Agrarwirtschaft gehörten Nutzungsformen, die einem modernen Verständnis von Grundeigentum zuwider liefen: so etwa die Transhumanz, bei der Tierherden im jahreszeitlichen Wechsel hunderte von Kilometern zurücklegten, die Waldweide oder die gemeinschaftlich bewirtschafteten Allmenden. Deren Auflösung war ein zentrales Konfliktfeld der europaweiten Agrarrevolution und ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Vermarktung der Agrarproduktion. Die Fernweidewirtschaft verlor hingegen eher schleichend ihre Bedeutung, indem der Wandel des Bodens im Zusammenspiel mit dem Drang, das Land intensiver zu nutzen, solche Formen der Bewirtschaftung zunehmend unattraktiv werden ließ.
Mit dem Wandel von Bodenrecht und Bodennutzung rückte die Frage einer Landreform europaweit auf die politische Agenda. Selbst in Finnland, wo man das Problem doch eigentlich durch die Rodung des üppig verfügbaren Waldes hätte entschärfen können, wurde die Änderung der Grundbesitzstrukturen zugunsten der landlosen bäuerlichen Bevölkerung zu einem politischen Schlüsselthema. Im finnischen Fall wurden die sozialen Konflikte auf dem Lande durch eine umfassende Agrarreform entschärft, die das gerade unabhängig gewordene Finnland Anfang der 1920er Jahre in Angriff nahm.5 Solche Entschlossenheit scheint allerdings europaweit eher die Ausnahme gewesen zu sein. Die Abwanderung besitzloser Landbewohner in die Stadt war als Ventil für die sozialen Spannungen ländlicher Gesellschaften vermutlich wirkungsvoller als politische Reformprogramme.
Eine umfassende Neuordnung der Besitzverhältnisse auf dem Lande gab es jedenfalls nur in sozialistischen Ländern (➔ Medien Link #aj). Die Kollektivierung der Landwirtschaft war ein stark umkämpfter Eckpfeiler der sozialistischen Agrarpolitik (➔ Medien Link #ak), der dann noch nach der Wende 1990 erheblichen gesellschaftlichen Sprengstoff barg. Das Spektrum der postsozialistischen Lösungen reicht von umfassender Privatisierung wie etwa in Litauen bis hin zu unsystematisch-unklaren Politiken mit endemischer Korruption wie in Rumänien.6 Während die Frage der Landreform in Asien, Afrika und Lateinamerika in den vergangenen beiden Jahrzehnten erneut virulent wurde, ist davon in Europa wenig zu spüren.7 Allerdings wäre das möglicherweise anders, wenn die Klagen früherer Großgrundbesitzer gegen die ostdeutsche Bodenreform nicht vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gescheitert wären.
Betreten verboten! Die Frage des Zugangs
Die Frage des Bodenrechts besitzt noch einen weiteren Aspekt, der zumindest kurz angesprochen werden soll. Das Recht des modernen Menschen auf Bewegungsfreiheit kollidiert nämlich tendenziell mit dem privaten Grundbesitz. Das fällt in der Landwirtschaft nicht allzu sehr ins Auge, in der Erholung dienenden Gebieten bietet die Frage des Betretens von privatem Grund hingegen eine Menge Konfliktstoff. Nur wenige Länder haben in dieser Frage eine so einheitliche Regelung geschaffen wie die skandinavischen Länder mit ihrem von Urlaubern und Einheimischen hochgeschätzten Jedermannsrecht, das prinzipiell allen Menschen gestattet, sich auf jedem Territorium frei zu bewegen. In der englischen Klassengesellschaft hingegen hat das Gebot des no trespassing eine lange, konfliktreiche Tradition.
Im 19. Jahrhundert verursachten Betretungsrechte allgemein noch Reibungen, so etwa bezüglich der Waldgebiete. Hier liefen die Forstreformen auf einen jahrzehntelangen Kampf um das staatliche Nutzungsmonopol hinaus. Inzwischen hat die politische Virulenz solcher Themen allerdings deutlich abgenommen. Die Funktion des Waldes (➔ Medien Link #al) als Rückzugsraum bedrohter Völker, die in anderen Teilen der Welt noch in der jüngsten Vergangenheit vom mexikanischen Bundesstaat Chiapas bis zum Ho-Chi-Minh-Pfad zu beobachten ist, ging in Europa schon im 19. Jahrhundert durch die Macht europäischer Territorialstaaten verloren. Nur die folkloristische Verehrung von Wilderern wie etwa Georg Jennerwein (1848–1877) (➔ Medien Link #am) in Bayern lässt noch erahnen, welches Konfliktpotential hier einst existierte.
Bodenschätze
Die erwähnte Angleichung von Eigentumsvorstellungen in Europa ging interessanterweise einher mit erheblichen Divergenzen im juristischen Umgang mit den Stoffen, die sich unter der Erdoberfläche befinden. Als extreme Gegensätze lassen sich die völlige Bergfreiheit (das heißt ein unbeschränktes Recht der Ausbeutung von Bodenschätzen durch den Finder) und ein pauschaler staatlicher Eigentumsvorbehalt (etwa in Form des mittelalterlichen Bergregals) benennen, wobei letzterer in der Moderne zumeist durch Konzessionssysteme für die Privatwirtschaft abgemildert wurde. Zwischen diesen beiden Wegen fächert sich ein breites Spektrum von Lösungsansätzen auf, das nicht nur nach Staaten, sondern auch nach Rohstoffen differenziert. Das Bergrecht scheint einer der wenigen Bereiche des Wirtschaftsrechts in Europa zu sein, vor dessen Harmonisierung selbst die Europäische Union zurückschreckt. Als einheitliches Merkmal lässt sich jedoch eine prononcierte Parteilichkeit für den Bergbau erkennen, entstanden aus der transnationalen Ansicht, dass die Gewinnung von Bodenschätzen besonders im Interesse einer Volkswirtschaft liege, aber zugleich besondere Risiken für Unternehmer berge: "Fast alle Rechtssysteme sind deshalb dazu gelangt, die Arbeit des Schürfens zu erleichtern und sogar anzuspornen."8
Die unterschiedlichen Gesetzgebungen haben den Umgang mit dem Boden freilich weniger geprägt als die geologischen Bedingungen und die technologisch-industriellen Komplexe, die die jeweiligen Rohstoffe zu Tage förderten. Kein anderer Industriezweig hat den Boden so brutal umgestaltet wie der Bergbau des 20. Jahrhunderts: mit gigantischen Fördermaschinen, riesigen Tagebauen und anderen Technologien, die zum Beispiel das nördliche Ruhrgebiet in eine Polderlandschaft verwandelten, in der die Pumpen nie abgestellt werden durften. Der Bergbau vormoderner Jahrhunderte wirkt dagegen geradezu pittoresk, und das nicht nur, weil mit Tagebauförderung und technischer Durchrationalisierung völlig neuartige Massen bewegt wurden. Der Rammelsberg bei Goslar ist inzwischen ebenso UNESCO-Weltkulturerbe wie das dazugehörige System von künstlichen Seen und Bächen, und auch das polnische Steinsalzbergwerk Wieliczka (➔ Medien Link #an) konnte diesen begehrten Titel erringen.
Die Folgen für den Boden waren zwar lokal begrenzt, dort jedoch massiv, zumal eine gründliche Rekultivierung selbst im wohlregulierten Deutschland erst nach heftigen Konflikten zur Selbstverständlichkeit wurde. Seit dem 19. Jahrhundert wuchs die Distanz zwischen den Orten, an denen gefördert, produziert und verarbeitet wurde, und der konsumierenden Gesellschaft. Das änderte sich selbst in der jüngsten Vergangenheit nur bedingt, was sich unter anderem in den Protesten gegen neue Kraftwerksprojekte in Hamburg-Moorburg oder Datteln zeigt, die sich vor allem auf die klimaschädlichen Emissionen konzentrieren und die Frage nach der Herkunft der Importkohle nur selten stellen. Transnationale Netzwerke existierten im Bergbau aber schon im 19. Jahrhundert, und das nicht nur bei Edelmetallen. Die Stahlfirma Krupp besaß zum Beispiel seit 1872 Eisenerzvorkommen in Spanien und bezog in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg mehr als 80 Prozent ihres Erzbedarfs aus dem Ausland.9
Boden als Wissensobjekt
Wenige Themen zeigen so nachdrücklich die Kluft zwischen Wissensgeschichte und Wissenschaftsgeschichte (➔ Medien Link #ao).10 Der Bergbau war längst ein Wirtschaftszweig mit Wissensunternehmern und beamteten Experten, als die Erzförderung unter Tage im 18. Jahrhundert durch die Gründung von Bergakademien in Freiberg und Schemnitz akademisiert wurde. Die bekannteste Dokumentation der Bergbautechnik im 16. Jahrhundert liefert das 1556 posthum erschienene Buch De Re Metallica von Georgius Agricola (1494–1555) (➔ Medien Link #ap).
Expertenwissen über den Boden entstand mithin auf ganz pragmatische Weise, da es für die Exploration wertvoller Mineralien benötigt wurde. Die Geologie als wissenschaftliche Disziplin entstand erst im frühen 19. Jahrhundert und besaß eine Bedeutung weit jenseits des Gegenstands. Im Streit zwischen Neptunisten und Plutonisten wurden zugleich Weltanschauungen verhandelt: Während die erstere Lehrmeinung die Sedimente als Ursprung der Gesteine verstand und konservativem Denken affin war, konnte die plutonistische Beachtung des Vulkanismus als metaphorische Umschreibung der Revolution gelesen werden. Zudem ermöglichte die geologische Wissenschaft eine enorme Erweiterung des zeitlichen Rahmens der menschlichen Geschichte.11
Die Bodenkunde als Wissenschaft der obersten Erdschicht entwickelte sich ein gutes Jahrhundert später, wobei sie ebenso wie die Geologie einen hohen Grad von Internationalisierung aufweist. Das spiegelt sich auch darin, dass die Gründung einer internationalen wissenschaftlichen Vereinigung der deutschen vorausgriff bzw. letztere erst initiierte. Die Internationale Bodenkundliche Gesellschaft (➔ Medien Link #aq) wurde 1924 im Internationalen Landwirtschaftsinstitut in Rom (der Vorläuferorganisation der heutigen Food and Agriculture Organization (➔ Medien Link #ar) der Vereinten Nationen) gegründet, zwei Jahre später entstand als eine von mehr als einem Dutzend nationaler Sektionen die Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft (➔ Medien Link #as).12 Dabei besaß die deutsche Wissenschaft auch in der Bodenkunde Weltgeltung, vielleicht am besten verkörpert durch das zehnbändige Handbuch der Bodenlehre, das der Göttinger Ordinarius Edwin Blanck (1877–1953) (➔ Medien Link #at) von 1929 bis 1939 herausgab.13
Geologie und Bodenkunde waren in erster Linie beschreibende, klassifizierende Disziplinen, die nicht zwingend auf Kausalmodelle angewiesen waren. Von daher war es für die wissenschaftliche Arbeit nicht grundsätzlich problematisch, dass die für das heutige Verständnis geologischer Ereignisse zentrale Theorie der Kontinentaldrift erst im 20. Jahrhundert zum allgemein akzeptierten Wissen wurde. In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass auch das Erdbeben selbstverständlich zur Geschichte des Bodens gehört, gerade weil man es aus europäischer Sicht leicht unterschätzt. Es gehört zu den Paradoxien der Umweltgeschichte, dass das Erdbeben von San Francisco 1906 ins kollektive Gedächtnis der Vereinigten Staaten einging, während die Erinnerung an das weitaus opferreichere Erdbeben von Messina zwei Jahre zuvor nur regional gepflegt wird.14
Das Mysterium der Fruchtbarkeit
Unter den Eigenschaften des Bodens hat dessen Fruchtbarkeit seit jeher eine besondere Bedeutung besessen. Die Fähigkeit, Pflanzen hervorzubringen und zu ernähren, ist bis heute nicht in allen Einzelteilen erforscht, da es sich um ein komplexes Zusammenspiel chemischer, physikalischer und biologischer Prozesse handelt. Als erste Komponente wurden die chemischen Grundlagen der Bodenfruchtbarkeit zum Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen, wobei die Deutschen Carl Sprengel (1787–1859) (➔ Medien Link #au) und Justus von Liebig (1803–1873) (➔ Medien Link #av) eine international anerkannte Schlüsselrolle spielten. Die von ihnen begründete Agrikulturchemie wurde zur wissenschaftlichen Grundlage der seit Mitte des 19. Jahrhunderts boomenden Düngungslehre. Schwerer tat sich die Forschung mit der Frage nach den physikalischen Voraussetzungen, die erst im 20. Jahrhundert von Bodenphysik und Kolloidchemie intensiv studiert wurden. Die größten Probleme bereiteten aber die biologischen und dabei vor allem die mikrobiologischen Grundlagen der Bodenfruchtbarkeit, auch weil die Vielfalt der daran beteiligten Bakterienarten geradezu überwältigend ist. Gerne wird der Boden als "den Regenwald des kleinen Mannes" bezeichnet, weil schon ein Esslöffel fruchtbarer Boden es von der Artenvielfalt her mit dem Amazonasbecken aufnehmen kann.15
Immerhin reichte das wissenschaftliche Verständnis, um die Fruchtbarkeit des Bodens gezielt zu steuern. Im Zusammenspiel mit einer systematischen Saatgutentwicklung und besserem Pflanzenschutz entwickelte sich die Mineraldüngung zu einer zentralen Voraussetzung für den säkularen Aufschwung der Hektarerträge, der den Hunger in Europa zu einer fernen Erinnerung gemacht hat. Die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit machte die Dystopien von Thomas Robert Malthus (1766–1834) (➔ Medien Link #aw) im europäischen Kontext obsolet, hatte aber freilich auch ihren Preis: Bodenerosion, Belastung von Grund- und Oberflächenwasser mit ungenutzten Nährstoffen sowie die Abhängigkeit der Agrarproduktion von betriebsfremden Ressourcen gehören zu den spürbaren Folgen, und vieles spricht dafür, dass diese Nebenwirkungen der chemieintensiven Agrarproduktion im 21. Jahrhundert an Brisanz gewinnen werden.16
Missachtungen
Damit ist bereits das letzte Kapitel dieses kursorischen Problemaufrisses erreicht. Die Geschichte des Bodens in der Moderne ist auch die Geschichte seiner Geringschätzung als Lebensgrundlage. Gewiss gibt es keinen Grund, vormoderne Wirtschaftsmethoden pauschal als nachhaltig zu kategorisieren. Die Waldstreunutzung – die Verwendung von Laub und Reisig für die Stallwirtschaft – war für die Humusbilanz der Waldböden zum Beispiel eine enorme Belastung und insofern die wohl destruktivste aller vormodernen Waldnutzungen. Aber der Weg zur industriellen Agrarproduktion der Gegenwart war auch von einem simplifizierten Bild des fruchtbaren Bodens geprägt, der im Extremfall zu einem Zwischenspeicher für Pflanzennährstoffe auf dem Weg von der chemischen Fabrik zum Lebensmittel reduziert wurde. Die enormen, technisch durchaus vermeidbaren Verluste von Bodenfruchtbarkeit, die die Agrarproduktion im 20. Jahrhundert charakterisierten, sind ein Resultat dieser verkürzten Sicht.17
Während Landwirte immerhin noch ein gewisses Eigeninteresse am Erhalt der Bodenfruchtbarkeit verspürten, herrschte unter Stadtmenschen nicht selten blankes Unverständnis. Saubere Luft und sauberes Wasser waren Kernanliegen der paneuropäischen Hygienebewegung, während ein gesunder Boden allenfalls die Kleingärtner sowie die Spezialisten vom Grünflächenamt interessierte. Nur die auf Hippokrates von Kos (um 460–370 v. Chr.) (➔ Medien Link #ax) zurückgehende Miasmentheorie, die in aus dem Boden entströmenden Gerüchen eine Krankheitsursache vermutete, förderte noch ein gewisses Interesse am Boden, das nach ihrer Widerlegung und dem Siegeszug der Bakteriologie in der Medizin im späten 19. Jahrhundert spurlos verschwand. Bis heute ist das Interesse an Bodenerosion und ähnlichen Themen in den urbanisierten Gesellschaften des Westens gering.
Zur Geschichte des Bodens in der Moderne gehört deshalb auch die zunehmende Versiegelung durch Gebäude, Straßen und andere Infrastrukturen. Seinen Ausgangspunkt nahm diese Entwicklung im 19. Jahrhundert, als Städte über ihre ursprüngliche Ummauerung hinauswuchsen (die dann oft abgerissen wurde) und Verkehrsverbindungen in wachsender Zahl die Landschaft durchkreuzten. Nach 1945 gewann diese Entwicklung durch Automobilismus und Suburbanisierung weitere Dimensionen, die die Landschaften Europas veränderten. Insofern erscheint es symptomatisch, dass sich die Menschen Europas alljährlich in der Sommerzeit vor allem an Sandstränden versammeln, die für das Wachstum von Pflanzen nahezu vollkommen ungeeignet sind.
Eine europäische Geschichte?
Keiner der skizzierten Prozesse war eine europäische Besonderheit. Suburbanisierung und Straßenbau, Intensivierung der Landnutzung und Förderung von Bodenschätzen sind wahrhaft globale Prozesse, und das europäische Konzept von Bodeneigentum hat sich weltweit durchgesetzt. Die Grenzen der Nationalstaaten werden nach der Erfahrung blutiger Auseinandersetzungen allenthalben akzeptiert und nur gelegentlich noch in Frage gestellt, etwa in Großbritannien oder im spanischen Baskenland. Grenzkorrekturen gab es seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast nur noch durch den Zerfall von Staaten: Die Sowjetunion, Jugoslawien, Pakistan, Osttimor und jüngst der Sudan sind einschlägige Fälle.
Lässt sich vor diesem Hintergrund eine spezifisch europäische Signatur in der Geschichte des Bodens erkennen? Der wohl wichtigste Faktor für die Interaktion von Mensch und Boden, die Bevölkerungsdichte, lässt keine eindeutige Tendenz erkennen. Die meisten europäischen Länder lassen sich in der Mitte zwischen der drangvollen Enge von Japan, Korea oder den chinesischen Küstenregionen und den menschenleeren Weiten Australiens, Kanadas und Argentiniens einordnen. Dennoch lassen sich meines Erachtens fünf Gründe identifizieren, warum die Geschichte des Bodens in Europa vielleicht etwas weniger dramatisch verlief als im Rest der Welt.
- Das rasante Wachstum, das europäische Großstädte um 1900 charakterisierte, verlangsamte sich im 20. Jahrhundert, zum Teil gab es sogar einen Rückgang der Bevölkerungszahl; mit Wien beherbergt Europa die einzige Großstadt weltweit, die seit dem Ende des Ersten Weltkriegs kontinuierlich schrumpft. Es gibt einen markanten Kontrast zwischen dem intensiven Wachstum der extrem dicht besiedelten Megastädte im Globalen Süden und dem europäischen Städtewachstum nach 1945, das eher dem in der Charta von Athen beschriebenen aufgelockerten, funktional gegliederten Modell folgte.
- Die gesellschaftliche Distanz zur Agrarwirtschaft ist zudem in Europa größer als in anderen Erdteilen, so dass die Konkurrenz um landwirtschaftliche Nutzflächen ihre soziale Sprengkraft verloren hat. Die Virulenz des Themas der Landreformen im Globalen Süden steht also im Kontrast zu einem ausgeprägten europäischen Desinteresse an den Besitzstrukturen auf dem Lande.
- Auch fehlte im Europa des 19. Jahrhunderts, anders als im Rest der Welt, eine Frontier-Erfahrung. Nur Russland erlebte mit der Kultivierung der Steppe eine dramatische Expansion der verfügbaren Fläche.18 Die eifrigen Bemühungen um die innere Kolonisation, also die Urbarmachung ungenutzter Flächen des eigenen Staatsgebiets, in Deutschland und anderen Ländern dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies keine markanten Auswirkungen auf den Flächenvorrat oder kollektive Mentalitäten hatte. Einen Frontier Spirit kannte Europa allenfalls regional begrenzt an der Peripherie, und es gab dort auch keine Bemühungen, wie das in den Vereinigten Staaten bis etwa 1900 der Fall war, Boden und mineralische Ressourcen möglichst schnell und zu geringen Kosten in private Hand zu bringen.
- Dahinter verbirgt sich ein wesentlicher Vorsprung Europas in der globalen Geschichte des Bodens: Der Übergang zu modernen Eigentumsvorstellungen vollzog sich hier sehr früh und häufig vor der Epoche der Industrialisierung (➔ Medien Link #ay). Während Bergrecht und Katastersysteme sich im Globalen Süden erst im Zuge der Inkorporierung in die Weltwirtschaft herausbildeten, gehörten sie in Europa zu den Rahmenbedingungen, die im industriellen Zeitalter nicht mehr grundsätzlich in Frage gestellt wurden. Schon allein die Regelung, dass auf den Boden bezogene Rechtstitel der Schriftlichkeit bedurften – man denke nur an das englische Domesday Book, in dem bereits Wilhelm I. von England (1028–1087) (➔ Medien Link #az) die Grundbesitzstrukturen seines Reichs dokumentieren ließ –, war eine folgenreiche Errungenschaft. Die heftigen Konflikte zwischen Ländern des Globalen Südens und multinationalen Konzernen lassen erahnen, dass Europa hier auch mit Blick auf die Geschichte des Bodens einiges erspart geblieben ist.
- Die klimatischen und geographischen Bedingungen bewahrten Europa im Allgemeinen vor landwirtschaftlichen Krisen. Viele europäische Regionen verfügen über gute, humusreiche Böden und eine relativ gleichmäßige Verteilung des Regens über das Jahr; sie haben also die Möglichkeit, ohne künstliche Bewässerung Landwirtschaft zu betreiben. Damit besitzt Europas Boden eine inhärente Fehlertoleranz, die beim Projekt der Agrarintensivierung einen gewissen Sicherheitspuffer bot. Vermutlich lassen sich die gravierenden Folgen der Industrialisierung der Agrarproduktion in weiten Teilen des Globalen Südens auch darauf zurückführen, dass die Natur dort aus klimatischen und ökologischen Gründen sehr viel schneller gefährdet war. Inwiefern dieser europäische Vorteil auch unter den Bedingungen der globalen Erwärmung erhalten bleibt, wird abzuwarten sein. Die in Spanien spürbare Angst vor Desertifikation könnte sich in dieser Hinsicht als Menetekel erweisen.






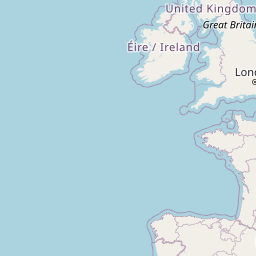

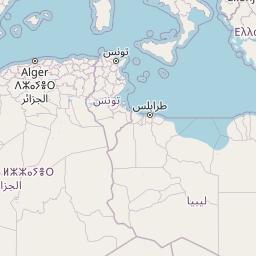
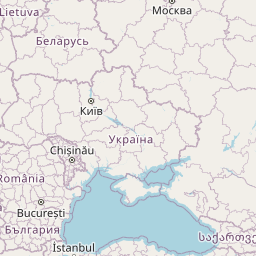
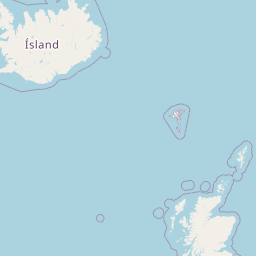

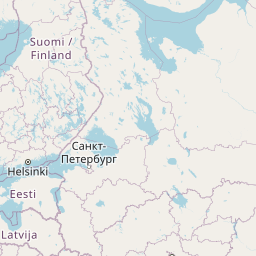


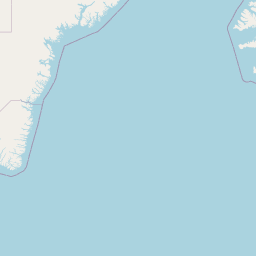

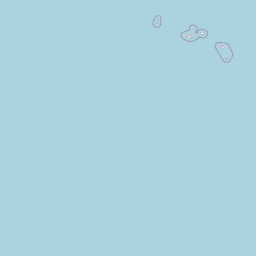




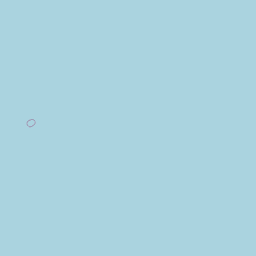






![Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft Drakendorf IMG Kurbjuhn: Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft Drakendorf, Schwarz-weiß-Photographie, 1953; Bildquelle: Deutsches Bundesarchiv, Bild 183-18524-0003, http://www.bild.bundesarchiv.de/cross-search/search/_1328881679/?search[view]=detail&search[focus]=128.](./illustrationen/boden/landwirtschaftliche-produktionsgenossenschaft-drakendorf-img/@@images/image/thumb)




