Einleitung
Das 16. Jahrhundert war für die akademische Medizin eine Zeit des Umbruchs. Der humanistischen Forderung ad fontes folgend, waren die ersten Jahrzehnte geprägt durch die Wiederentdeckung antiker medizinischer Schriften, die zusehends die mittelalterlichen Übersetzungen und Kommentare als grundlegende Texte der gelehrten Medizin ablösten.1 Von besonderer Bedeutung waren die Schriften des spätantiken Arztes Galenos von Pergamon (129 bis nach 204)[ ]. Galens Werke waren erstmals im Jahr 1525 in einer griechischen Gesamtausgabe erschienen2 – ein Ereignis, das in den folgenden Jahrzehnten eine Flut von neuen lateinischen Übersetzungen, Kommentaren und Kurzfassungen von Galentexten nach sich zog.3 Man kann nicht oft genug betonen, dass diese Texte im 16. Jahrhundert nicht als historische Quellen gelesen wurden, sondern als aktuelle Instrumente gültiger wissenschaftlicher Erkenntnis galten.
]. Galens Werke waren erstmals im Jahr 1525 in einer griechischen Gesamtausgabe erschienen2 – ein Ereignis, das in den folgenden Jahrzehnten eine Flut von neuen lateinischen Übersetzungen, Kommentaren und Kurzfassungen von Galentexten nach sich zog.3 Man kann nicht oft genug betonen, dass diese Texte im 16. Jahrhundert nicht als historische Quellen gelesen wurden, sondern als aktuelle Instrumente gültiger wissenschaftlicher Erkenntnis galten.
Das gründliche Studium der antiken Mediziner führte jedoch zu einem Phänomen, das Richard Toellner als "humanistisches Paradoxon" bezeichnet hat: Die entschiedene Hinwendung zu den alten Quellen und deren immer besser werdende Kenntnis eröffnete den Raum für Kritik an den antiken Autoritäten.4 Anders gesagt: Je besser man Galen kannte, desto deutlicher traten die Widersprüche in dessen Büchern zutage. Dies wurde in besonderer Weise in der Anatomie deutlich: Hier war es vor allem Andreas Vesal (1515–1564)[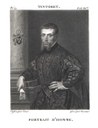 ],5 der zunächst eine typisch humanistische Aufgabe – die Übersetzung von Galentexten zur Anatomie – übernommen hatte und der dabei feststellen musste, dass Galens Darstellung nicht selten von seinen eigenen Sektionsbefunden abwich. Der Ausgang der Geschichte ist bekannt: In der Praefatio zu seinen 1543 publizierten De humani corporis fabrica libri septem
],5 der zunächst eine typisch humanistische Aufgabe – die Übersetzung von Galentexten zur Anatomie – übernommen hatte und der dabei feststellen musste, dass Galens Darstellung nicht selten von seinen eigenen Sektionsbefunden abwich. Der Ausgang der Geschichte ist bekannt: In der Praefatio zu seinen 1543 publizierten De humani corporis fabrica libri septem führte Vesal aus, dass er an mehr als 200 Stellen nachgewiesen habe, dass Galen gar keine Menschen, sondern Tiere seziert habe und dass dessen Aussagen zur Anatomie daher immer der Überprüfung an der menschlichen Leiche bedürften.6
führte Vesal aus, dass er an mehr als 200 Stellen nachgewiesen habe, dass Galen gar keine Menschen, sondern Tiere seziert habe und dass dessen Aussagen zur Anatomie daher immer der Überprüfung an der menschlichen Leiche bedürften.6
Vesals Fabrica stieß nicht überall und sofort auf ungeteilte Zustimmung. Schon kurz nach dem Erscheinen des Buches musste sich Vesal mit heftigster Kritik seines Pariser Lehrers Jacques Dubois (Sylvius) (1478–1555) auseinandersetzen, der die für das 16. Jahrhundert nicht untypische Auffassung vertrat, die Differenzen zwischen Sektionsbefunden und galenischem Text seien darauf zurückzuführen, dass sich seit den Zeiten Galens die menschlichen Körper verändert hätten. Auf keinen Fall aber habe sich Galen geirrt. Dubois wollte die Autorität Galens nicht angegriffen sehen, und er stand mit dieser Einstellung nicht allein.7
Die Auseinandersetzung mit seinen wissenschaftlichen Gegnern hat Vesal zum Helden der Anatomiegeschichtsschreibung gemacht: Mit ihm – so kann man vielfach lesen8 – hätten die Abkehr von den antiken Personalautoritäten und die Hinwendung zur neuzeitlichen Naturbeobachtung, der "Autopsia" im Wortsinn, begonnen. Mit Vesal hätten die Anatomen angefangen, an die Stelle der Autorität des gedruckten Buchstabens die Autorität des menschlichen Körpers zu setzen, wie er sich dem Wissenschaftler bei der Sektion darstellt.
Für die Universitäten nördlich der Alpen ist diese Sicht nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Betrachtet man die Universität Wittenberg und die gleichzeitig blühende Universität in Ingolstadt, so lassen sich tatsächlich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts anatomische Sektionen in einer größeren Häufigkeit als in der ersten Jahrhunderthälfte nachweisen.9 Das bedeutet jedoch nicht, dass Anatomie nach einer neuen Methode gelehrt und gelernt wurde. Die Grundlage des anatomischen Unterrichts waren nach wie vor Bücher, nur veränderte sich im Laufe des Jahrhunderts die Liste der Werke, die das als verbindlich geltende Bild des menschlichen Körpers vermittelten.10 Waren es bis zur Jahrhundertmitte im Wesentlichen die Texte Galens, wurden diese nun ergänzt durch die Werke der neueren Anatomen wie Andreas Vesal, Charles Estienne (1504–1564) und Gabriele Fallopio (1523–1562).
in einer größeren Häufigkeit als in der ersten Jahrhunderthälfte nachweisen.9 Das bedeutet jedoch nicht, dass Anatomie nach einer neuen Methode gelehrt und gelernt wurde. Die Grundlage des anatomischen Unterrichts waren nach wie vor Bücher, nur veränderte sich im Laufe des Jahrhunderts die Liste der Werke, die das als verbindlich geltende Bild des menschlichen Körpers vermittelten.10 Waren es bis zur Jahrhundertmitte im Wesentlichen die Texte Galens, wurden diese nun ergänzt durch die Werke der neueren Anatomen wie Andreas Vesal, Charles Estienne (1504–1564) und Gabriele Fallopio (1523–1562).
Die hier aufgezeigten Entwicklungen in der Medizin und besonders in der Anatomie des 16. Jahrhunderts treten deutlich im Werk des Wittenberger Humanisten und Reformators Philipp Melanchthon (1497–1560)[ ] zutage.11 In der Folge soll der Einfluss der neu verfügbaren Galentexte und der neueren Anatomen auf Melanchthons häufig nachgedruckte und viel gelesene Schrift De anima aufgezeigt werden. Dieser Text ist erstmals 1540 als Commentarius de anima12 und 1552 in stark überarbeiteter Form als Liber de anima erschienen.13 Er gehörte bis ins 17. Jahrhundert zur Standardlektüre an artistischen und medizinischen Fakultäten protestantischer Universitäten.14
] zutage.11 In der Folge soll der Einfluss der neu verfügbaren Galentexte und der neueren Anatomen auf Melanchthons häufig nachgedruckte und viel gelesene Schrift De anima aufgezeigt werden. Dieser Text ist erstmals 1540 als Commentarius de anima12 und 1552 in stark überarbeiteter Form als Liber de anima erschienen.13 Er gehörte bis ins 17. Jahrhundert zur Standardlektüre an artistischen und medizinischen Fakultäten protestantischer Universitäten.14
Der "Commentarius de anima" von 1540
Melanchthon beabsichtigte ursprünglich nicht, Seele und Körper des Menschen zum Gegenstand eines eigenen Lehrbuchs zu machen. Im Jahr 1534 betrachtete er die Lehre vom Menschen noch als Bestandteil der allgemeinen Naturkunde, der Physica, als er in einem Brief an Leonhart Fuchs (1501–1566) die Absicht bekundete, in seinem geplanten Lehrbuch zur Naturkunde auch den Menschen und besonders die Anatomie des menschlichen Körpers darstellen zu wollen:
Wenn wir nun zur Natur des Menschen und der Seele gelangen, möchte ich unbedingt die Anatomie, die Eigenschaften der Teile sowie die Verschiedenheiten der Temperamente, also die Ursachen und Arten der menschlichen Mischungen, einfügen. Diese Dinge werden in den gewöhnlichen Werken zur Naturkunde nicht erwähnt.15
Dabei wolle er aus den Schriften Galens, nicht aus den zeitgenössischen anatomischen Lehrbüchern, ein ordentliches Werk erstellen. Fuchs möge ihm helfen, die zu diesem Zweck geeignetsten Galenstellen zu finden.16 Auch an seinen Freund Joachim Camerarius (1500–1574) richtete Melanchthon eine ähnliche Bitte.17
Melanchthon veröffentlichte dann allerdings seine Abhandlung über die Seele und die Natur des Menschen, den Commentarius de anima![Commentarius de Anima IMG Commentarius de Anima von Philipp Melanchthon, Vitebergae 1550, Scan der Buchinnenseite, Bildquelle: http://dfg-viewer.de/show/?set[mets]=http%3A%2F%2Fmdz10.bib-bvb.de%2F~db%2Fmets%2Fbsb00012821_mets.xml](./illustrationen/galen-rezeption-im-16.-jahrhundert-am-beispiel-philipp-melanchtons/commentarius_img/@@images/image/thumb) , bereits im Jahr 1540, während das Lehrbuch zur Naturkunde, die Initia doctrinae physicae,18 erst im Jahr 1549 erschien. Sein Versprechen jedoch, in seiner Seelenlehre auch die Anatomie des Menschen zu behandeln, hat Melanchthon eingelöst: Die anatomische und physiologische Beschreibung des Menschen umfasst nahezu die Hälfte des Buches. Damit unterscheidet sich Melanchthons Commentarius von allen anderen Schriften des 16. Jahrhunderts, die den Titel De anima tragen19. Zwar wurde auch von anderen Autoren, die über die Seele schrieben, ab der Mitte des 16. Jahrhunderts zunehmend auf der Basis anatomischer Kenntnisse argumentiert,20 aber in keiner anderen psychologischen Schrift dieser Zeit findet sich eine ähnlich entschlossene Hinwendung zu anatomischen Inhalten wie bei Melanchthon, auch nicht in den De anima et vita libri tres21 des spanischen Humanisten Juan Luis Vives (1492–1540)[
, bereits im Jahr 1540, während das Lehrbuch zur Naturkunde, die Initia doctrinae physicae,18 erst im Jahr 1549 erschien. Sein Versprechen jedoch, in seiner Seelenlehre auch die Anatomie des Menschen zu behandeln, hat Melanchthon eingelöst: Die anatomische und physiologische Beschreibung des Menschen umfasst nahezu die Hälfte des Buches. Damit unterscheidet sich Melanchthons Commentarius von allen anderen Schriften des 16. Jahrhunderts, die den Titel De anima tragen19. Zwar wurde auch von anderen Autoren, die über die Seele schrieben, ab der Mitte des 16. Jahrhunderts zunehmend auf der Basis anatomischer Kenntnisse argumentiert,20 aber in keiner anderen psychologischen Schrift dieser Zeit findet sich eine ähnlich entschlossene Hinwendung zu anatomischen Inhalten wie bei Melanchthon, auch nicht in den De anima et vita libri tres21 des spanischen Humanisten Juan Luis Vives (1492–1540)[ ],22 deren Lektüre Melanchthon im Widmungsschreiben zu seinem Commentarius ausdrücklich empfahl.23
],22 deren Lektüre Melanchthon im Widmungsschreiben zu seinem Commentarius ausdrücklich empfahl.23
Der weitaus größte Teil der Galenzitate und -paraphrasen begegnet erwartungsgemäß im anatomischen Teil des Commentarius. Melanchthon benannte und beschrieb hier die äußeren Körperteile, stellte die drei Leibeshöhlen und die wichtigsten Organe dar und ging auf die Säfte und die spiritus ein. Galen erscheint hier als die anatomische Autorität. Aulus Cornelius Celsus (ca. 25 v.Chr. – ca. 50 n.Chr.), Plinius der Ältere (23-79), Avicenna (980–1037) und die Arabes werden gelegentlich erwähnt,24 ohne tiefere Spuren zu hinterlassen, und Jacopo Berengario (ca. 1460–ca. 1530) als einziger Zeitgenosse wird an einer Stelle offen kritisiert.25 Inwiefern die zahlreichen Verweise auf Galen26 im Commentarius auf eine genuine Lektüre Melanchthons hindeuten oder auf die Hilfe zeitgenössischer Experten wie Camerarius oder Fuchs zurückzuführen sind, ist heute schwer zu beurteilen. Sicher ist aber, dass Melanchthon in allen anatomischen Streitfragen die Aussage Galens entscheiden ließ, den er – wie er an anderer Stelle schrieb – als die "Quelle der Medizin" ansah, aus der "wie Bächlein" alle Schriften der späteren Ärzte entsprungen seien.27
Einige Beispiele sollen Melanchthons Vorgehen verdeutlichen: Bei der Darstellung des Aufbaus von Kehlkopf und Kehldeckel wies er darauf hin, dass die "Neueren" den Begriff ἐπιγλωττίς für den gesamten Kehlkopf verwendet hätten. Galen hingegen habe ohne Zweifel mit γλωττίς und ἐπιγλωττίς nur jenes Zünglein gemeint, das die trachea arteria beim Essen und Trinken verschließe und welches das wichtigste Instrument zur Veränderung der Stimme sei.28 Auch in der im 16. Jahrhundert infolge der besseren Kenntnis galenischer Physiologie heftig diskutierten Frage nach Anzahl und Art der spiritus im menschlichen Körper29 folgte Melanchthon der Ansicht Galens. Galen selbst habe die Existenz eines dritten spiritus, des spiritus naturalis in der Leber, bezweifelt, sodass es wahrscheinlicher sei, dass die Leber den für die Blutbereitung benötigten spiritus über Arterien vom Herzen erhalte:
Andere fügten einen dritten hinzu, nämlich den spiritus naturalis in der Leber, der das Blut erwärmt und Dämpfe im Blut aufsteigen lässt. Aber Galen zweifelt, ob er diese Art annehmen soll, indem er sagt: 'Wenn es das natürliche Pneuma gibt'. Denn wenn es auch nötig ist, dass spiritus in der Leber ist, wird dieser durch die Arterien dorthin gebracht. Und die Aufgabe dieses spiritus, den man vitalis nennt, ist, mit lebensspendender Wärme die Herstellung des Blutes zu fördern.30
Galens Autorität zeigt sich auch in der von Melanchthon präferierten Zeugungstheorie. Die aristotelische Lehre, nach der die Frau über keinen eigenen Samen verfügt, sondern mit dem Menstrualblut lediglich das Material für den Fötus bereitstellt, wird unter Berufung auf Galen abgelehnt; stattdessen folgte Melanchthon den Ausführungen Galens in De semine, indem er im Sinne der Zweisamentheorie behauptete, dass sich der Embryo aus der Verbindung von männlichem und weiblichem Samen entwickele:
Wenn die Gebärmutter den Samen des Mannes aufgenommen hat, verbindet sich mit dem männlichen Samen der weibliche Samen. Hier besteht ein großer Streit, ob die Frau aktiv zur Zeugung der Leibesfrucht beiträgt. Aristoteles gestand der Frau keinen Samen zu, sondern sagte, dass der Stoff für die Leibesfrucht das Menstrualblut sei und dass sich der Samen des Mannes aktiv verhalte. Er verwandle sich in spiritus und ordne mit seiner Kraft wie ein Handwerker jenen Stoff an, sodass von dort aus der Foetus erzeugt werde. Dies ist die Zusammenfassung der Auffassung des Aristoteles. Diese wird aber von Galen mit vielen Einwänden zurückgewiesen, weshalb wir Galen folgen wollen, der verneint, dass das Menstrualblut der Stoff für die Leibesfrucht sei, sondern lehrt, dass die verbundenen Samen des Mannes und der Frau der Stoff für den Foetus seien. Wenn auch von diesen der Samen des Mannes wärmer und dicker ist und der Samen der Frau feuchter und kälter, so sagt er, dass dieser deswegen gewissermaßen Nahrung für den männlichen Samen darstelle.31
Der Ausnahmestellung seiner Abhandlung war sich Melanchthon durchaus bewusst: "Nun kehre ich zu den üblichen Fragen zurück, die in den Schulen normalerweise in einem Buch über die Seele behandelt werden",32 schrieb er am Ende des anatomischen Teils, um sich im zweiten Abschnitt des Commentarius tatsächlich den Fähigkeiten der menschlichen Seele, den potentiae animae, zuzuwenden. Melanchthons nun verfolgter psychologischer Ansatz war weitgehend an der aristotelischen Tradition orientiert.33 Der Reihe nach und in ihrer hierarchischen Ordnung von unten nach oben handelte er fünf Seelenvermögen ab, nämlich die potentia vegetativa, sentiens, appetitiva, locomotiva und rationalis, also das vegetative, das empfindende und das begehrende Vermögen sowie die Fähigkeit der Ortsbewegung und das Denkvermögen. Auch in diesen Zusammenhängen ging Melanchthon immer wieder auf anatomische und physiologische Aspekte ein, etwa bei der Frage nach der Entstehung von Hunger und Durst oder bei speziellen Problemen der Physiologie der inneren und der äußeren Sinne. Überlagert wird die aristotelische Gliederung der Seelenvermögen durch die von Platon (ca. 427 – ca. 347 v.Chr.) entwickelte und von Galen übernommene Dreiteilung der Seele, nach der die denkende Seele (λoγιστικόv) in das Gehirn, die leidenschaftliche Seele (θυμoειδές) in das Herz und die begehrende Seele (ἐπιθυμητικόv) in die Leber lokalisiert werden.34 Ganz zu Anfang seines Buches hatte Melanchthon unter Hinweis auf Platon entsprechende Galenstellen aus De placitis und Quod animi mores zitiert.35
Diese als "klassisch" zu bezeichnenden Elemente der Seelenlehre bilden am Ende der Abhandlung die begriffliche Basis für Melanchthons Ausführungen zur Sündhaftigkeit des Menschen. Das Gefüge von Affekten des Herzens, von angeborenen Kenntnissen und inneren Sinnen des Gehirns ist durch die Sünde zutiefst gestört, die Kenntnis Gottes im Verstand ist verschüttet, die Leidenschaften werden durch kein Gesetz gelenkt, und die Begierden bestimmen das Handeln des Menschen. "Dies ist das ungeheure Elend der Menschen, das freilich erkannt und beklagt werden muss."36 In dieses disharmonische Gefüge greife das Erlösungshandeln Gottes ein, um den neuen Menschen hervorzubringen, dessen Affekte mit dem Willen Gottes im Einklang stünden und dessen natürliche Gotteserkenntnis nicht mehr verdunkelt sei.37
Diese letzten Abschnitte des Buches erklären auch, weshalb Melanchthon es für unabdingbar hielt, im Rahmen der Seelenlehre ausführlich auf die Anatomie des Menschen einzugehen. Melanchthons Aussagen über die menschliche Sünde und das göttliche Handeln am Menschen entbehrten gewissermaßen ihrer empirischen Grundlage, wäre nicht in den vorhergehenden Kapiteln des Buches akribisch aufgezeigt worden, wie die inneren Sinne des Gehirns arbeiten und mit den äußeren Sinnen in Verbindung stehen oder wie die Affekte durch verschiedene Bewegungen des Herzens hervorgerufen werden.38 Und um diese Dinge richtig zu verstehen, hielt er es auch für wichtig, die grobe Anatomie des Körpers zu kennen, die Verteilung der Organe auf die drei Körperhöhlen, den Aufbau und auch die Funktion der einzelnen Körperteile sowie ihren Zusammenhang untereinander. Denn über die Seele, so hatte Melanchthon am Anfang des Commentarius geschrieben, könne man nur a posteriori Kenntnis erlangen: Allein von den beobachtbaren Tätigkeiten der Seele, ihren actiones, lasse sich auf die zugrundeliegenden Seelenvermögen rückschließen; dazu aber sei es unabdingbar, dass man die Körperteile und Organe kenne, mit denen die Seele diese actiones verrichtet.39
Melanchthons Commentarius de anima versuchte nichts anderes, als die Seelenlehre, mit der seine Vorstellungen von der grundsätzlichen Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen eng verknüpft sind, in der Wissenschaft vom Aufbau des menschlichen Körpers zu verankern. Aber in Melanchthons Augen leistete die Anatomie noch mehr: Mehr als alle anderen Wissenschaften zeige sie, dass die Natur nicht aus zufällig zusammengesetzten Atomen bestehe, sondern dass ein schöpferischer Geist am Werke gewesen sei. Angesichts des kunstvollen Aufbaus des menschlichen Körpers könne man den Plan und die Sorgfalt des Schöpfers erkennen; die Anatomie offenbare wie keine andere Wissenschaft die vestigia divinitatis, die Spuren der Gottheit, die diese in ihrer Schöpfung hinterlassen habe.40
Eine so verstandene Anatomie diene dann eben nicht nur der Erhaltung der Gesundheit, sondern auch – indem sie an die Weisheit des Schöpfergottes erinnere – der Sittlichkeit des Betrachters41, und es sei geradezu schändlich für einen Menschen, das Gebäude seines Körpers nicht kennenlernen zu wollen.42ENDNOTE 42 Zudem habe bereits Galen gesagt, dass die Betrachtung des menschlichen Körpers zur Anerkennung eines herrschenden Geistes in der Natur und eben damit zur Erkenntnis Gottes führe.43 Galen, dessen teleologische Aussagen in De usu partium dieser Behauptung Melanchthons zugrundeliegen könnten,44 ist an dieser Stelle also nicht nur Gewährsmann für bestimmte anatomische Lehrsätze, sondern er wird zum Kronzeugen für eine religiös interpretierte Anatomie, welche die Absichten Gottes in seiner Schöpfung offenbart.45
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Galen in Melanchthons Commentarius de anima von 1540 die uneingeschränkte Autorität darstellt in allen Fragen, welche die Anatomie des menschlichen Körpers berühren. Dieses Galenbild wird ergänzt durch eine christlich-reformatorische Interpretation ausgewählter Zitate, die den antiken Arzt zum Zeugen einer religiös verstandenen Anatomie machen und die seine an Platon orientierten Aussagen über die Dreiteilung der Seele benutzen, das Erlösungshandeln Gottes am Menschen zu beschreiben.
Der "Liber de anima" von 1552
In seinen Briefen zeigte sich Melanchthon wenig zufrieden mit dem Commentarius. Von Leonhart Fuchs offensichtlich auf einige anatomische Fehler aufmerksam gemacht, versprach er bald nach dem Erscheinen des Buches eine Überarbeitung.46 Erst 12 Jahre später jedoch, im November 1552, war die veränderte Fassung, der Liber de anima , fertiggestellt. Melanchthon hatte einige Umstellungen in der Anordnung des Stoffs vorgenommen und den Text des Commentarius deutlich gestrafft. Der Argumentation sind die Veränderungen sehr gut bekommen: Viele Aussagen erscheinen klarer und besser begründet als im Commentarius.47
, fertiggestellt. Melanchthon hatte einige Umstellungen in der Anordnung des Stoffs vorgenommen und den Text des Commentarius deutlich gestrafft. Der Argumentation sind die Veränderungen sehr gut bekommen: Viele Aussagen erscheinen klarer und besser begründet als im Commentarius.47
Von medizinhistorischer Seite wurde dem Liber de anima besondere Aufmerksamkeit zuteil, weil Melanchthon nun in dem anatomischen Abschnitt auch auf das 1543 erschienene Hauptwerk des Paduaner Anatomen Andreas Vesal zurückgriff. Von den eingangs angedeuteten Streitigkeiten um Vesals Fabrica unbeeindruckt, bearbeitete Melanchthon intensiv sein eigenes Exemplar des Buches, das er zudem mit einem eigens verfassten Gedicht versah.48 Aus einem Brief an Johannes Stigel (1515–1562) vom Juni 1549 geht hervor, dass er die durch die Vesal-Lektüre gewonnenen Erkenntnisse bei der geplanten Neuauflage seines Lehrbuches über die Seele verwenden wollte.49
Im Liber de anima lässt sich dann tatsächlich an vielen Stellen der Einfluss Vesals nachweisen.50 In einem der Eingangskapitel wird die Fabrica als "locupletissimum opus viri peritissimi"51 ("das sehr reichhaltige Werk eines äußerst kenntnisreichen Mannes") gelobt, und an drei Stellen wies Melanchthon ausdrücklich auf die Verbesserungen hin, die die anatomische Lehre durch Vesal erfahren habe. So habe allein Vesal die Anatomie des Kehlkopfes richtig beschrieben, indem er klar unterschieden habe zwischen γλωττìς und ἐπιγλωττìς.52 Auch habe Vesal die Anatomie des Sprunggelenks als erster in korrekter Weise dargestellt,53 und er habe bewiesen, dass die fünflappige Leber vielleicht beim Schwein, aber in keinem Falle beim Menschen zu finden sei.54
Neben diesen ausdrücklichen Verweisen auf Vesals Fabrica finden sich im Liber de anima auch Änderungen in der Darstellung der menschlichen Anatomie, die zwar sicher mit Melanchthons Vesal-Lektüre im Zusammenhang stehen, die aber nicht expressis verbis mit Vesal verbunden werden. Hatte Melanchthon im Commentarius noch das πλέγμα δικτυoειδἑς Galens – das "netzförmige Geflecht", das in der medizinischen Tradition zum "wunderbaren Netz" (rete mirabile) wurde – ausführlich besprochen und ihm ein eigenes Kapitel gewidmet,55 so heißt es im Liber lediglich, dass Galen zwar dieses Geflecht beschrieben habe, dass man nun aber seine Existenz verneine: "Sed in capite hominis hunc insignem contextum negant esse" ("Aber man bestreitet, dass dieses besondere Geflecht im Kopf des Menschen vorhanden ist").56 Melanchthon wählte die unpersönliche Form negant; er verriet dem Leser nicht, dass er die neue Information der Fabrica Andreas Vesals verdankte.57 In ähnlicher Weise wird die im Commentarius stark an Galen orientierte Beschreibung akzessorischer Gallengänge, die in den Magen münden und erhebliche Beschwerden nach sich ziehen,58 – sicher aufgrund der ablehnenden Haltung Vesals59 – im Liber ganz entscheidend gekürzt und mit dem Satz "Sed haec rara exempla omitto" ("Aber diese seltenen Beispiele übergehe ich") beendet, wiederum allerdings ohne eine Erwähnung Vesals.60 Man gewinnt an diesen Textstellen den Eindruck, dass Melanchthon durch stillschweigende Übernahmen Vesal'scher Verbesserungen eine direkte Konfrontation der beiden anatomischen Koryphäen Galen und Vesal vermeiden und Widersprüche zwischen ihnen nicht offen zutage treten lassen wollte.
In diesem Zusammenhang ist nochmals daran zu erinnern, dass die Anatomie in Melanchthons De anima zwar eine wichtige Rolle, aber nicht die Hauptrolle spielte. Für Melanchthon war anatomisches Wissen Bestandteil einer Anthropologie, die den Zustand des Menschen nach dem Fall und das Handeln Gottes an eben diesem Menschen erklärte. Für diese Grundfragen des Menschseins war es eigentlich unerheblich, ob die anatomischen Kenntnisse von Galen oder Vesal stammten; wichtiger war eine klare und widerspruchsfreie Lehre, die natürlich auch den Tatsachen entsprechen sollte.61 Ganz offensichtlich sah Melanchthon keinen gravierenden Gegensatz zwischen der antiken Autorität und dem zeitgenössischen Anatomen, sondern betrachtete das Werk Andreas Vesals in erster Linie als eine zusammenfassende und illustrierende Ergänzung der immer noch gültigen Anatomie und Physiologie Galens.62 Vesals Fabrica wich zwar in einigen Details von den antiken Texten ab und bot in einigen dieser Abweichungen tatsächlich die "bessere" anatomische Lehre, sie konnte für Melanchthon aber die grundsätzliche Autorität Galens nicht in Frage stellen.63
Deutlich stärker ausgeprägt als im Commentarius ist im Liber die Verbindung zwischen dem anatomisch-physiologischen Teil in der ersten Hälfte des Buches und den theologischen Ausführungen am Schluss. Melanchthon verknüpfte nun die spiritus-Lehre Galens64 mit Überlegungen von der Wirkung des heiligen Geistes im Menschen: Der spiritus sanctus vermische sich bei frommen Menschen mit den körperlichen spiritus in Herz und Gehirn und bewirke auf diese Weise, "dass die Erkenntnis Gottes klarer wird, die Zustimmung fester, und dass die Bewegungen zu Gott glühender werden."65 Offenkundig hatte Melanchthon erst bei der Überarbeitung des Commentarius erkannt, welche zusätzlichen Möglichkeiten die galenische Anatomie und Physiologie auch dem Theologen bieten. Umso mehr lässt sich aber auch nachvollziehen, dass er diese Anatomie als ein harmonisches Ganzes präsentieren wollte und dass er deshalb Konflikten zwischen verschiedenen Lehrmeinungen auszuweichen suchte.
Jürgen Helm
Anhang
Quellen
Berengario da Carpi: Isagogae breves et exactissimae in anatomiam humani corporis, Nürnberg 1530. URL: https://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb11268196-3 [2021-09-06]
Galen: Galeni librorum partes I–V, Venedig 1525.
Galen: De methodo medendi, hg. von Carl Gottlob Kühn, Leipzig 1821 (Claudii Galeni opera omnia, vol. X).
Galen: De placitis Hippocratis et Platonis, hg. von Phillip DeLacy, 2. Aufl. Berlin 1981–1984 (Corpus medicorum Graecorum 5,4,1,2).
Galen: Quod animi mores corporis temperamenta sequantur, hg. von Carl Gottlob Kühn, Leipzig 1821 (Claudii Galeni opera omnia, vol. IV).
Galen: De semine, hg. von Phillip DeLacy, Berlin 1992 (Corpus medicorum Graecorum 5,3,1).
Galen: De usu partium, hg. von Carl Gottlob Kühn, Leipzig 1821 (Claudii Galeni opera omnia, vol. III/IV).
Melanchthon, Philipp: Briefwechsel: Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften hg. von Heinz Scheible, Stuttgart-Bad Cannstatt 1977–2009.
Melanchthon, Philipp: Commentarius de anima, Wittenberg 1540. URL: https://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10169882-1 [2021-09-06]
Melanchthon, Philipp: Corpus Reformatorum: Philippi Melanthonis opera quae supersunt omnia, hg. von Carl Gottlieb Bretschneider u.a., Halle u.a. 1834–1860.
Melanchthon, Philipp: Liber de anima, recognitus ab Autore Philippo Melanth., Wittenberg 1552.
Vesal, Andreas: De humani corporis fabrica libri septem, Basel 1543. URL: https://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10860962-2 [2021-09-06]
Vives, Johannes Ludov.: De anima et vita libri tres, Basel 1538. URL: https://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10192181-9 [2021-09-06]
Literatur
Baader, Gerhard: Die Antikerezeption in der Entwicklung der medizinischen Wissenschaft während der Renaissance, in: Rudolf Schmitz u.a. (Hg.): Humanismus und Medizin, Weinheim 1984, S. 51–66.
Baader, Gerhard: Medizinische Theorie und Praxis zwischen Arabismus und Renaissancehumanismus, in: Gundolf Keil u.a. (Hg.): Der Humanismus und die oberen Fakultäten, Weinheim 1987, S. 185–213.
Baader, Gerhard: Medizinisches Reformdenken und Arabismus im Deutschland des 16. Jahrhunderts, in: Sudhoffs Archiv 63 (1979), S. 261–296. URL: https://www.jstor.org/stable/20776606 [2021-09-06]
Cunningham, Andrew: The Anatomical Renaissance: The Resurrection of the Anatomical Projects of the Ancients, Aldershot u.a. 1997. URL: https://doi.org/10.4324/9781315241418 [2021-09-06]
Delmas, André: Geschichte der Anatomie, in: Illustrierte Geschichte der Medizin, Vaduz u.a. 1992, vol 2., S. 851–909.
Durling, Richard J.: A Chronological Census of Renaissance Editions and Translations of Galen, in: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 24 (1961), S. 230–305. URL: https://doi.org/10.2307/750797 [2021-09-06]
Ebeling, Gerhard: Disputatio de homine: Erster Teil: Text und Traditionshintergrund, Tübingen 1977 (Lutherstudien 2/1).
Eckart, Wolfgang U.: Philipp Melanchthon und die Medizin, in: Günter Frank u.a. (Hg.): Melanchthon und die Naturwissenschaften seiner Zeit, Sigmaringen 1998, S. 183–202.
French, Roger K.: Natural Philosophy and Anatomy, in: Jean Céard u.a. (Hg.): Le corps à la Renaissance: Actes du XXXe colloque de Tours 1987, Paris 1990, S. 447–460.
Gloy, Karen: Art. "Naturphilosophie", in: TRE (Theologische Realenzyklopädie) 24 (1994), S. 118–132. URL: https://www.degruyter.com/database/ TRE/entry/tre.24_118_17/html [2021-09-06]
Haendler, Klaus: Wort und Glaube bei Melanchthon: Eine Untersuchung über die Voraussetzungen und Grundlagen des melanchthonischen Kirchenbegriffes, Gütersloh 1968 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 37).
Hankinson, Robert James: Galen's Anatomy of the Soul, in: Phronesis 36/1 (1991), S. 197–232. URL: https://www.jstor.org/stable/4182386 [2021-09-06]
Helm, Jürgen: Die Galenrezeption in Philipp Melanchthons De anima (1540/1552), in: Medizinhistorisches Journal 31 (1996), S. 298–321. URL: https://www.jstor.org/stable/25805164 [2021-09-06]
Helm, Jürgen: "Medicinam aspernari impietas est": Zum Verhältnis von Reformation und akademischer Medizin in Wittenberg, in: Sudhoffs Archiv 83 (1999), S. 22–41. URL: https://www.jstor.org/stable/20777698 [2021-09-06]
Helm, Jürgen: Die spiritus in der medizinischen Tradition und in Melanchthons Liber de anima, in: Günter Frank u.a. (Hg.): Melanchthon und die Naturwissenschaften seiner Zeit, Sigmaringen 1998, S. 219–237.
Hofmann, Siegfried: Leichensektionen im 16. Jahrhundert in Ingolstadt, in: Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt 83 (1974), S. 284–286.
Koch, Hans-Theodor: Anatomie als universitäres Lehrfach: Das Beispiel Wittenberg, in: Jürgen Helm u.a. (Hg.): Anatomie: Sektionen einer medizinischen Wissenschaft im 18. Jahrhundert, Stuttgart 2003, S. 163–188.
Koch, Hans-Theodor: Bartholomäus Schönborn (1530–1585): Melanchthons de anima als medizinisches Lehrbuch, in: Heinz Scheible (Hg.): Melanchthon in seinen Schülern, Wiesbaden 1997, S. 323–339.
Koch, Hans-Theodor: Melanchthon und die Vesal-Rezeption in Wittenberg, in: Günter Frank u.a. (Hg.): Melanchthon und die Naturwissenschaften seiner Zeit, Sigmaringen 1998, S. 203–218.
Kollesch, Jutta: Galens Auseinandersetzung mit der aristotelischen Samenlehre, in: Jürgen Wiesner (Hg.): Aristoteles: Werk und Wirkung, Berlin 1987, vol. 2, S. 17–26.
Kusukawa, Sachiko: The Transformation of Natural Philosophy: The Case of Philip Melanchthon, Cambridge 1995.
Kutzer, Michael: Tradition, Anatomie und Psychiatrie: Die mentalen Vermögen und ihre Gehirnlokalisationen in der frühen Neuzeit, in: Medizinhistorisches Journal 28 (1993), S. 199–228. URL: https://www.jstor.org/stable/25805064 [2021-09-06]
Lembke, Sven: Wie der menschliche Leichnam zu einem Buch der Natur ohne Druckfehler wird: Über den epistemologischen Wert anatomischer Sektionen im Zeitalter Vesals, in: Zeitsprünge: Forschungen zur Frühen Neuzeit 9 (2005), S. 19–49.
Lesky, Erna: Die Zeugungs- und Vererbungslehren der Antike und ihr Nachwirken, Mainz 1951 (Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse 1950, Nr. 19).
Mani, Nikolaus: Die Editio princeps des Galen und die anatomisch-physiologische Forschung im 16. Jahrhundert, in: Fritz Krafft u.a. (Hg.): Das Verhältnis der Humanisten zum Buch, Boppard 1977, S. 209–226.
Mani, Nikolaus: Die griechische Editio princeps des Galenos (1525), ihre Entstehung und ihre Wirkung, in: Gesnerus 13 (1956), S. 29–52. URL: https://doi.org/10.1163/22977953-0130102002 [2021-09-06]
Matz, Wolfgang: Der befreite Mensch: Die Willenslehre in der Theologie Philipp Melanchthons, Göttingen 2001 (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 81). URL: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00040043-1 [2021-09-06]
Nickel, Diethard: Untersuchungen zur Embryologie Galens, Berlin 1989 (Schriften zur Geschichte und Kultur der Antike 27).
Nutton, Vivian: The Anatomy of the Soul in Early Renaissance Medicine, in: Gordon R. Dunstan (Hg.): The Human Embryo: Aristotle and the Arabic and European Traditions, Exeter 1990, S. 136–157.
Nutton, Vivian: De placitis Hippocratis et Platonis in the Renaissance, in: Paola Manuli u.a. (Hg.): Le opere psicologiche di Galeno: Atti del terzo colloquio galenico internazionale Pavia, 10–
Nutton, Vivian: Wittenberg Anatomy, in: Ole Peter Grell u.a. (Hg.): Medicine and the Reformation, London 1993, S. 11–32.
O'Malley, Charles Donald: Andreas Vesalius of Brussels 1514–1564, Berkeley u.a. 1964.
Park, Katharine: The Organic Soul, in: Charles B. Schmitt (Hg.): The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge 1988, S. 464–484.
Park, Katharine / Kessler, Eckhard: The Concept of Psychology, in: Charles B. Schmitt (Hg.): The Cambridge History of Renaissance Philosophy, Cambridge 1988, S. 455–463.
Rath, Gernot: Andreas Vesal im Lichte neuer Forschungen, Wiesbaden 1963.
Rosenau, Hartmut: Art. "Natur", in: TRE 24 (1994), S. 98–107.
Roth, Moritz: Andreas Vesalius Bruxellensis, Berlin 1892.
Scheible, Heinz: Art. "Melanchthon", in: TRE 22 (1992), S. 371–410.
Schüling, Hermann: Bibliographie der psychologischen Literatur des 16. Jahrhunderts, Hildesheim 1967 (Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie 4).
Sonntag, Michael: "Gefährte der Seele, Träger des Lebens": Die medizinischen Spiritus im 16. Jahrhundert, in: Gerd Jüttemann u.a. (Hg.): Die Seele: Ihre Geschichte im Abendland, Weinheim 1991, S. 165–179.
Sperl, Adolf: Melanchthon zwischen Humanismus und Reformation: Eine Untersuchung über den Wandel des Traditionsverständnisses bei Melanchthon und die damit zusammenhängenden Grundfragen seiner Theologie, München 1959 (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus, 10. Reihe, vol. 15).
Stiening, Gideon: Psychologie, in: Barbara Bauer (Hg.): Melanchthon und die Marburger Professoren (1527–1627), Marburg 1999 (Schriften der Universitätsbibliothek Marburg 89), vol. 1, S. 315–344.
Sudhoff, Walther: Die Lehre von den Hirnventrikeln in textlicher und graphischer Tradition des Altertums und Mittelalters, in: Archiv für Geschichte der Medizin 7 (1913), S. 149–205. URL: https://www.jstor.org/stable/20773035 [2021-09-06]
Temkin, Owsei: On Galen's Pneumatology, in: Gesnerus 8 (1951), S. 180–189. URL: https://doi.org/10.1163/22977953-0080102018 [2021-09-06]
Toellner, Richard: Zum Begriff der Autorität in der Medizin der Renaissance, in: Rudolf Schmitz u.a. (Hg.): Humanismus und Medizin, Weinheim 1984, S. 159–179.
Toellner, Richard: "Renata dissectionis ars": Vesals Stellung zu Galen in ihren wissenschaftsgeschichtlichen Voraussetzungen und Folgen, in: August Buck (Hg.): Die Rezeption der Antike, Hamburg 1981, S. 85–95.
Walker, Daniel P.: Medical Spirits and God and the Soul, in: Marta Fattori u.a. (Hg.): Spiritus: IV. Colloquio Internazionale, Roma, 7–9 gennaio 1983, Rom 1984 (Lessico Intellettuale Europeo XXXII), S. 223–244.
Wittern, Renate: Die Gegner Andreas Vesals: Ein Beitrag zur Streitkultur des 16. Jahrhunderts, in: Florian Steger u.a. (Hg.): Gesundheit – Krankheit: Kulturtransfer medizinischen Wissens von der Spätantike bis in die Frühe Neuzeit, Köln u.a. 2004, S. 167–199.
Anmerkungen
- ^ Zu den Entwicklungen in der akademischen Medizin des 16. Jahrhunderts vgl. die Studien Gerhard Baaders: Baader, Reformdenken 1979; Ders., Antikerezeption 1984; Ders., Theorie 1987.
- ^ Galen, librorum 1525.
- ^ Zur Galen-Aldina vgl. Mani, Griechische Editio princeps 1956; Ders., Editio princeps 1977; zu den Ü
- ^ Toellner, Autorität 1984, Zitat auf S. 175.
- ^ Zu Andreas Vesal und seinem Werk: Roth, Andreas Vesalius 1892; Rath, Andreas Vesal 1963; O'Malley, Andreas Vesalius 1964; Toellner, Dissectionis ars 1981; Cunningham, Renaissance 1997, S. 88–142.
- ^ Vesalius, Fabrica 1543, Praef. fol. 2v.
- ^ Vgl. O'Malley, Andreas Vesalius 1964, S. 238–240, S. 248–251; Toellner, Dissectionis ars 1981, S. 89–90; French, Natural Philosophy 1990, S. 451–454; Wittern, Gegner 2004.
- ^ Vgl. z.B. Delmas, Geschichte 1992, S. 868–869.
- ^ Zu Wittenberg vgl. Koch, Anatomie 2003, S. 169–172; zu Ingolstadt vgl. Hofmann, Leichensektionen 1974.
- ^ Vgl. Lembke, Buch 2005, besonders S. 40–48.
- ^ Zu Leben und Werk Melanchthons vgl. Scheible, Melanchthon 1992.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540.
- ^ Ders., Liber 1552. Der im 13. Band des Corpus Reformatorum (im Folgenden: CR) abgedruckten Textfassung lag die Ausgabe Wittenberg, Peter Seitz, 1553 (VD 16, M 2757), zugrunde. Der Liber de anima wird im Folgenden nach dem Text des CR zitiert.
- ^ Zahlreiche Drucke von Melanchthons De anima sind aufgeführt bei Schüling, Bibliographie 1967, S. 183–186. Zur Rezeption des Textes vgl. Koch, Schönborn 1997; Ders., Vesal-Rezeption 1998, S. 210–213; Eckart, Philipp Melanchthon 1998, S. 198–201; Stiening, Psychologie 1999, S. 334–341.
- ^ Brief an Fuchs vom 30. April 1534: CR 2, Nr. 1182, Sp. 718–719; vgl. Melanchthons Briefwechsel (im folgenden MBW) T6, Nr. 1430, S.79–81.
- ^ Ebd.
- ^ Briefe an Camerarius vom 7. Dezember 1533 (MBW.T5, Nr. 1384, S. 520–522; CR 2, Nr. 1145, Sp. 686–687) und vom 24. Januar 1534 (MBW.T6, Nr. 1400, S.35–36; CR 2, Nr. 1161, Sp. 699–700).
- ^ Digitalisat verfügbar auf der Homepage der Bayerischen Staatsbibliothek unter http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00032805/image_4.
- ^ Wie verbreitet diese Literaturgattung gewesen ist, beweist Schüling, Bibliographie 1967; vgl. zur Psychologie im 15. und 16. Jahrhundert auch Park / Kessler, Concept 1988.
- ^ Vgl. Park, Soul 1988, S. 482–484.
- ^ Digitalisat verfügbar auf der Homepage der Bayerischen Staatsbibliothek unter http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00032926/image_7.
- ^ Vives, De anima 1538.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, praef. fol. 4r.
- ^ Vgl. z.B. ebd., fol. 33v, 36v, 37v, 40r, 55v.
- ^ Ebd., fol. 106r–106v. Melanchthon wandte sich gegen Berengarios Auffassung, dass alle inneren Sinne in den beiden vorderen Ventrikeln lokalisiert seien. Vgl. Berengario, Isagogae 1530, im Abschnitt De medulla cerebri.
- ^ Vgl. Helm, Galenrezeption 1996: Melanchthon erwähnte 112 Mal den Namen Galens und zitierte aus mindestens 15 verschiedenen Galen-Schriften.
- ^ CR 3, Nr. 1652, Sp. 491; MBW.T8, Nr. 1996, S. 50–55. (Zunächst ungedruckt gebliebene Praefatio Melanchthons zur Baseler Galenausgabe von 1538, der zweiten griechischen Gesamtedition der Werke Galens [VD 16, G 119–G 123])
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, fol. 88r–88v: "In suprema parte est lingua in fistula, haec vocatur & ἐπιγλωττίς & γλωττίς a Galeno. Sed recentiores vocabulo Epiglottidis abusi sunt non pro hac lingula, sed pro tota larynge, hoc est, pro toto nodo gutturis. Galenus autem haud dubie vocat ἐπιγλωττίδα & γλωττίδα linguam fistulae." ("Im obersten Abschnitt befindet sich eine Zunge in der Röhre; von Galen wird diese als epiglottis und glottis bezeichnet. Aber die Neueren haben den Begriff Epiglottis falsch gebraucht, nämlich nicht für dieses Zünglein, sondern für den gesamten larynx, also für den gesamten Kehlkopf. Galen aber bezeichnet zweifellos das Zünglein der Röhre ohne Zweifel als epiglottis und glottis.") Vgl. auch Commentarius, fol. 89v–90r: "Altera chartilago est, quam Galenus vocat ἐπιγλωττίδα & γλωττίδα, est autem lingula similis linguis fistularum, alligata chartilagini scutali duobus musculis, quibus movetur. Constat autem ex membrana & chartilaginibus, ut dilatari & constringi possit in modulatione diversarum vocum, constat ex humida, pingui et viscosa carne, ne assiduo motu arescat, sed habeat nativam humiditatem, necessariam ad formandam vocem, sicut apparet in ardentibus febribus, difficulter loqui homines propter arefactam illam lingulam. Est autem duplex usus huius lingulae, est principale vocis modulandae instrumentum, & est operculum, quod claudit tracheam arteriam, ne in eam delabantur cibi aut potus." ("Es gibt einen zweiten Knorpel, den Galen als epiglottis und glottis bezeichnet. Das ist aber ein Zünglein, ähnlich den Zungen der Flöten, das mit dem Schildknorpel durch zwei Muskel, mit denen es bewegt wird, verbunden ist. Es besteht aus Haut und Knorpeln, damit es ausgedehnt und zusammengezogen werden kann bei der Erzeugung der verschiedenen Stimmen; es besteht (auch) aus einem feuchten, dicken und zähen Fleisch, damit es nicht durch die beständige Bewegung austrocknet, sondern eine ursprüngliche Feuchtigkeit besitzt, die notwendig ist zur Bildung der Stimme. So zeigt sich bei brennenden Fiebern, dass die Menschen mühsam sprechen, weil jenes Zünglein ausgetrocknet ist. Es gibt aber einen doppelten Nutzen dieses Züngleins: Es ist das hauptsächliche Werkzeug zur Veränderung der Stimme, und es ist das Deckelchen, das die Luftröhre verschließt, damit in sie weder Speisen noch Getränke hineingelangen.") Vgl. Galen, De usu partium 1821, III, S. 560–567 und S. 583–588.
- ^ Vgl. Nutton, De placitis 1988, S. 301–304.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, fol. 135v: "Alii addiderunt tertiam, scilicet spiritum naturalem in Epate, qui fovet sanguinem, & in sanguine halitus excitat. Sed Galenus dubitat an hanc speciem ponat, inquiens εἰ δὲ ἐστί τι πvεῦμα φυσικὸv. Nam etsi spiritum in Epate esse necesse est, tamen is per arterias eo transvehitur. Et actio est eius spiritus, qui vitalis vocatur, calore vivifico sanguinis generationem adiuvare." Vgl. Galen, De methodo medendi 1821, S. 839–840. Zur Pneumatheorie Galens vgl. Temkin, Galen's Pneumatology 1951.
- ^ Melanchthon, Commentarius, fol. 22r: "Cum matrix excepit semen viri, iungitur virili semini muliebre semen. Hic magna controversia est, an mulier concurrat active ad procreationem foetus. Aristoteles non tribuit semen mulieri, sed dixit materiam foetus esse sanguinem menstruum, & viri semen habere se active, ac verti in spiritum, & sua vi tanquam fabrum, materiam illam disponere, ut inde foetus procreetur. Haec est summa sententiae Aristotelis sed refellitur a Galeno multis rationibus, quare Galenum sequamur, qui negat menstruum sanguinem materiam esse foetus, sed docet materiam foetus esse, iuncta semina viri & mulieris. Etsi in his viri semen calidius & crassius est, at mulieris semen humidius ac frigidius, & ob hanc causam veluti nutrimentum esse virili semini, inquit." Vgl. Galen, De semine 1992, S. 86; zu Galens Zeugungslehre vgl. Kollesch, Galens Auseinandersetzung 1987; Nickel, Untersuchungen zur Embryologie 1989, S. 29–49; Lesky, Zeugungs- und Vererbungslehren 1951, S. 1349–1369 und S. 1401–1417.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, fol. 135v.
- ^ Vgl. Park, Soul 1988.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, 183r–184v. 196v–198r.
- ^ Ebd., fol. 5r–6r. Vgl. Galen, De placitis 1984, S. 438–440; Galen, Quod animi mores 1821, S. 782; zu Galens Platonismus vgl. Hankinson, Galen's Anatomy 1991, S. 198–208; zu Melanchthons Übernahme des platonischen Ansatzes vgl. Nutton, Anatomy 1990, S. 146–147.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, fol. 194v.
- ^ Ebd., fol. 235v–236r.
- ^ Für Adolf Sperl war Melanchthons reformatorische Entdeckung "primär eine psychologische Erkenntnis": Sperl, Melanchthon 1959, S. 100; vgl. auch Haendler, Wort 1968, S. 496–517 und S. 570–572; Matz, Mensch 2001, S. 241–231.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, Bl. 1r–1v.20r–21r. Den Disput zwischen Antiqui und Moderni, ob die Seelenvermögen realiter von der Seele getrennt seien oder ob die eine Seele nicht einfach in unterschiedlichen Organen verschiedene Wirkungen hervorrufe, sah Melanchthon damit zugunsten der Moderni entschieden: Groß und unbrauchbar sei dieser Streit gewesen, heißt es im Commentarius dazu. Es genüge festzuhalten, dass die Seelenvermögen durch die Organe unterschieden werden, und deshalb rede man vergeblich über die potentiae animae, wenn man nicht auch die Organe des menschlichen Körpers beschreibe. Vgl. Park, Soul 1988, S. 476–481; Ebeling, Disputatio 1977, S. 167–168 und S. 173–183.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, fol. 44v–45r. Dass die Betrachtung der Natur einen Weg zur Erkenntnis des Schöpfergottes darstellen kann, ist ein Gedanke, der sich durchgängig in verschiedenen philosophischen und theologischen Strömungen der Spätantike und des Mittelalters findet. Vgl. die Übersichten bei Rosenau, Natur 1994, S. 100–103, und bei Gloy, Naturphilosophie 1994, S. 120–126.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, fol. 19v: "Harum rerum cognitio, non solum iucunda est, sed etiam ad multas vitae partes utilis, ad valetudinis curam, ad regendos mores, ad monstranda quaedam divinitatis vestigia." ("Die Kenntnis dieser Dinge ist nicht nur erfreulich, sondern auch für viele Bereiche des Lebens nützlich, zur Erhaltung der Gesundheit, zur Lebensführung und dazu, einige Spuren der Gottheit aufzuzeigen.")
- ^ Ebd., fol. 32r: "Turpe est homini prorsus ignorare sui corporis, ut ita dicam, aedificium, presertim cum ad valetudinem, & ad mores haec cognitio plurimum conducat." ("Schändlich ist es geradezu für den Menschen, sozusagen das Bauwerk seines Körpers nicht zu kennen, besonders weil diese Kenntnis zur Gesundheit und zu den Sitten am meisten beiträgt.")
- ^ Ebd., fol. 1v–2r: "Quanta varietas, quam suavis cognicio, quam iucundum homini bene instituto a natura spectaculum est, sensuum actiones & earum causas, & mirificam organorum oeconomiam considerare? in qua cum manifeste appareat, naturam aliqua mente regi, Galenus praeclare dixit, Anatomiae scientiam, ducem nobis esse ad Dei cognitionem." ("Welch große Vielfalt, welch angenehme Erkenntnis, welch erfreuliches Schauspiel ist es für den von der Natur gut eingerichteten Menschen, die Tätigkeiten der Sinne und deren Ursachen sowie die wunderbare Ökonomie der Organe zu bedenken? Weil sich in ihr klar zeigt, dass die Natur von einem Geist beherrscht wird, sagt Galen sehr deutlich, dass die Wissenschaft der Anatomie für uns ein Führer zur Erkenntnis Gottes ist.")
- ^ Vgl. z.B. Galen, De usu partium 1821, III, S. 720; IV, S. 145, IV, S. 216–217.
- ^ Vivian Nutton weist darauf hin, dass diese religiöse Interpretation der Anatomie im 16. Jahrhundert nicht unüblich gewesen ist, dass aber die Verbindung zwischen Frömmigkeit und der Lehre vom menschlichen Körper in Wittenberg – in der Nachfolge Melanchthons – besonders eng war; vgl. Nutton, Wittenberg Anatomy 1993, S. 17–21. Zum Verhältnis von Anatomie und Reformation vgl. auch Helm, Medicinam aspernari 1999.
- ^ MBW.T9, Nr. 2579, S. 544–545; CR 3, Nr. 2083, Sp. 1211.
- ^ Vgl. Nutton, Anatomy 1990, S. 148–149.
- ^ Melanchthons Exemplar der Fabrica befindet sich heute in der US National Library of Medicine in Bethesda, Maryland (USA), vgl. Nutton, Wittenberg Anatomy 1993, S. 16 und S. 28, Anm. 21. Melanchthons Gedicht De consideratione humani corporis wurde abgedruckt in CR 10, Nr. 257, Sp. 610, und ist als Autograph leicht zugänglich in Kusukawa, Transformation 1995, S. 116–117. Vgl. auch das Digitalisat auf der Homepage der US National Library of Medicine: http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/vesalius_home.html.
- ^ MBW.R5, Nr. 5579, S.494; CR 7, Nr. 5137, Sp. 1015.
- ^ Bereits Moritz Roth hatte auf einige sachliche Änderungen hingewiesen, die auf den Einfluss der Fabrica zurückzuführen sind. Die zweite Auflage von De anima lasse – so Roth, Vesalius 1892, S. 244 – "die Einwirkung Vesals verspüren [...]. Sie enthält die richtige Unterscheidung von Glottis und Epiglottis, den wahren Ursprung der Vasa seminalia, die Einfachheit der Uterushöhle, sie erwähnt Hammer und Amboss des Gehörorganes. Der Verfasser sagt ferner, dass die menschliche Leber nicht die Lappen der Schweineleber besitze, dass die Poren der Herzscheidewand unsichtbar seien, dass man das Rete mirabile leugne. Beim Muskel schliesst er sich der Anschauung Vesals an". Zu den durch Vesal induzierten Änderungen in Melanchthons Text vgl. auch Eckart, Philipp Melanchthon 1998, S. 192–201.
- ^ CR 13, Sp. 21.
- ^ Ebd., Sp. 24. 61–62.
- ^ Ebd., Sp. 31.
- ^ Ebd., Sp. 41–42.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, fol. 97v und fol. 107r–107v.
- ^ CR 13, Sp. 72.
- ^ Vesal, Fabrica 1543, S. 310 und S. 642–643.
- ^ Melanchthon, Commentarius 1540, fol. 60v–61r.
- ^ Vesal, Fabrica 1543, S. 509–510.
- ^ CR 13, Sp. 43.
- ^ Vgl. Nutton, Wittenberg Anatomy 1993, S. 16–17 und S. 21–23.
- ^ Ebd., S. 17.
- ^ Dass Melanchthon nicht alle Auffassungen Vesals teilte, zeigt sich an der Lokalisation der inneren Sinne, die Vesal grundsätzlich in Frage stellte, die Melanchthon im Liber aber unverändert in den mittelalterlichen Schemata beließ. Vgl. CR 13, Sp. 120–122, und Vesal, Fabrica 1543, S. 623; zur Ventrikellokalisation vgl. Sudhoff, Lehre 1913; Kutzer, Tradition 1993.
- ^ CR 13, Sp. 10 und Sp. 88.
- ^ Ebd., Sp 88–89: "Et, quod mirabilius est, his ipsis spiritibus in hominibus piis miscetur ipse divinus spiritus, et efficit magis fulgentes divina luce, ut agnitio Dei sit illustrior, et adsensio firmior, et motus sint ardentiores erga Deum." Vgl. dazu Walker, Medical spirits 1984; Sonntag, Gefährte 1991; Helm, Spiritus 1998.

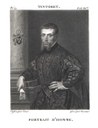



![Commentarius de Anima IMG Commentarius de Anima von Philipp Melanchthon, Vitebergae 1550, Scan der Buchinnenseite, Bildquelle: http://dfg-viewer.de/show/?set[mets]=http%3A%2F%2Fmdz10.bib-bvb.de%2F~db%2Fmets%2Fbsb00012821_mets.xml](./illustrationen/galen-rezeption-im-16.-jahrhundert-am-beispiel-philipp-melanchtons/commentarius_img/@@images/image/thumb)









